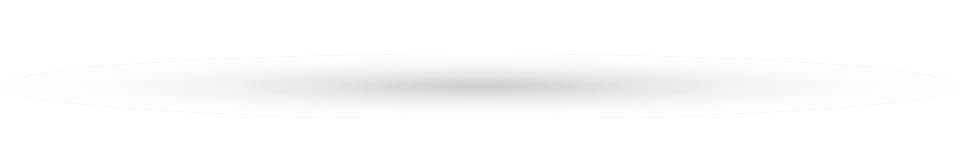
Sie sind auf professionelle rechtliche Beratung angewiesen? Sie suchen einen kompetenten Anwalt, der Ihr Recht, wenn nötig auch bei einer gerichtlichen Auseinandersetzung vertritt? Wir bieten Ihnen Know How in Form von langjähriger Erfahrung, Fachkompetenz und Kostenbewusstsein für nicht nur rechtliche, sondern auch wirtschaftlich zielführende Lösungen. Seit Gründung der Kanzlei im Jahr 2000 vertreten wir unsere Mandanten hauptsächlich [...]
... im Zivilrecht, Wirtschaftsrecht, Handels- und Gesellschaftsrecht, Arbeitsrecht, Schadenersatzrecht, Verkehrsrecht, Strafrecht, Versicherungsrecht und in der Regulierung von Ordnungswidrigkeiten.
Die Kernkompetenz unserer Rechtsanwaltskanzlei liegt im Bank- und Kapitalmarktrecht. Wir vertreten unsere Auftraggeber mit profunder Erfahrung auch aus jahrelanger bankinterner Tätigkeiten gegenüber unterschiedlichsten Vertragspartnern im Kredit- und Kreditsicherungsrecht, im Kapitalanlagerecht, im Bankaufsichtsrecht bei sämtlichen rechtlichen und wirtschaftlichen Fragestellungen, genauso wie im Interbankenverhältnis.
Als Vorsitzender des Fachausschusses für Bank- und Kapitalmarktrecht der Rechtsanwaltskammer Thüringen wird dies Gremium verlässlich betreut und der Austausch von Fachwissen gefördert. Unsere Stärken liegen in der persönlichen Betreuung, der rechtlichen und wirtschaftlichen Vertretung unserer Mandanten und der effizienten Mandatsführung sowie der Prozessvertretung vor Gericht. Wir sind Ihre vertrauensvolle Anlaufstelle für juristische Beratung in Erfurt und Umgebung, betreuen unser Klientel über unsere Rechtsanwaltskanzlei aber auch überregional. Durch die regelmäßige Teilnahme an Fort- und Weiterbildungsangeboten sind wir stets mit aktuellen Änderung der Rechtslage vertraut. Radsuchende profitieren von unserer juristischen Fähigkeit als Rechtsanwaltskanzlei, unseren Finanzmarktkenntnissen aus eigener Managementerfahrung als Führungskraft und Vorstand einer Bank und unserem weitreichenden Netzwerk in unterschiedlichen Branchenzweigen.
Vita
Ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht, zugelassen bei der Rechtsanwaltskammer Thüringen. Schwerpunkte meiner anwaltlichen Tätigkeit sind Bank- und Kapitalmarktrecht, Wirtschaftsrecht, Arbeitsrecht, Strafrecht, Versicherungsrecht und Zivilrecht. Nach dem Abitur und Wehrdienst schloss ich das Studium der Rechtswissenschaften 1997 an der Friedrich-Schiller-Universität Jena mit dem ersten Staatsexamen erfolgreich ab. [...]
Während meines Jurastudiums übte ich bereits eine mehrjährige Tätigkeit in einer in Freiburg/Breisgau ansässigen Kanzlei aus. Anschließend absolvierte ich das Rechtsreferendariat im Landgerichtsbezirk Erfurt, welches ich mit dem zweiten juristischen Staatsexamen im Februar 2000 abschloss. Im August des gleichen Jahres erfolgte die Zulassung als Rechtsanwalt. Zunächst war ich als Syndikus einer Bank in Erfurt, seit 2008 auch in Funktion als Prokurist berufen und übte dabei neben Tätigkeiten im Kreditbereich und Rechtsabteilung auch die Leitung der Human Resources Abteilung aus. Bis 2009 absolvierte ich ein Finanzmanagement Studium an der Steinbeis-Hochschule Berlin und der Akademie der Genossenschaften mit Auslandsaufenthalten an der Stern Business School New York und der SDA Bocconi Businessschool of Economics Milan. Dieses Studium schloss ich mit dem Finanz-Master of Business Administration (MBA) ab. Zeitnah dazu wurde ich mit der erworbenen Qualifikation nach § 25 c KWG zum Vorstand bei der Erfurter Bank eG berufen und übte dieses Amt bis 2018 aus. Seit 2009 bin ich darüber hinaus auf dem Gebiet des Bank- und Kapitalmarktrechtes als Fachanwalt tätig und begleite seit dieser Zeit auch den Vorsitz des Fachausschusses für Bank- und Kapitalmarktrecht bei der Rechtsanwaltskammer Thüringen. Ehrenamtlich engagiert bin ich im Rotary Club Erfurt.

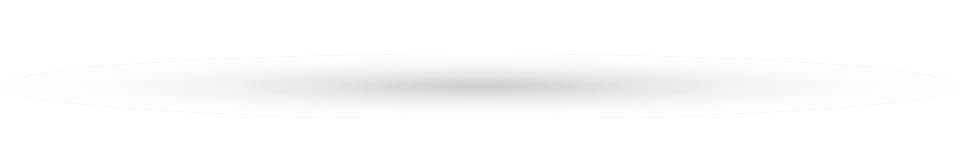
Kompetenzen
Rechtsanwalt
Rechtliche Auseinandersetzungen lassen sich durch das Aufkommen von Meinungsverschiedenheiten nicht vermeiden. Wir betreuen Sie juristisch getreu nach dem Kredo. „Vertrauen ist gut. Anwalt ist besser“ in allen rechtlichen Angelegenheiten [...]
Dabei kann die Rechtsanwaltskanzlei seit 2000 auf langjährige Erfahrung in den einschlägigen Bereichen zurückgreifen. Wir werden regelmäßig bevollmächtigt Ihr Recht vor allen Amts-, Land- und Oberlandesgerichten der Bundesrepublik Deutschland zu vertreten. Im Rahmen unserer Beratung bieten wir konkrete Lösungsmöglichkeiten, damit Ihre rechtlichen, aber auch wirtschaftlichen Strategien und Ziele realisiert werden können. Den zu erzielenden, wirtschaftlich umsetzbaren Lösungen messe ich höchste Priorität bei. Professionelles Arbeiten in Form von umfangreicher Rechtsberatung bei Beachtung aller denkbaren Facetten, Vertretung im außergerichtlichen Bereich und gerichtlichen Prozessen sowie die maximale Ausnutzung von rechtlichen Gestaltungsspielräumen gehören zum Kerngeschäft unserer juristischen Tätigkeit. Für uns ist es wichtig, Ihren individuellen Lebenssachverhalt zu kennen, damit eine wirtschaftlich sinnvolle Lösung gefunden werden kann. Der Erfolg des juristischen und wirtschaftlichen Vorhabens in Ihrem Auftrag steht für uns an der obersten Stelle. Die Verbindung von juristisch beratender Tätigkeit und des vorhandenen betriebswirtschaftlichen Hintergrundes sowie die langjährige Managementerfahrung des Kanzleiinhaber bilden dabei ein solides Kompetenzfundament zur optimalen Durchsetzung Ihrer Interessen.
Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht
Als einer der wenigen Fachanwälte für Bank- und Kapitalmarktrecht in Thüringen und als Vorsitzender des Fachausschusses für Bank- und Kapitalmarktrecht der Rechtsanwaltskammer Thüringen betreue ich schwerpunktmäßig Mandate, bei denen es sich um rechtliche Beziehungen innerhalb der Geschäftsverbindungen zwischen Bank und deren Kunden handelt. [...]
Die Geschäftsfelder im Interbankenverhältnis werden im Bank- und Kapitalmarktrecht genauso wie aufsichtsrechtliche und regulatorische und gesetzliche Anforderungen an Banken und Geschäftsleiter aus MaRisk oder bankspezifisches Aufsichtsrecht gegenüber den Aufsichtsbehörden behandelt.
Das Kreditvertrags- und Sicherungsrecht, der Zahlungsverkehr, die Vermögensverwaltung, der Wertpapierhandel sowie das Factoring und Leasing sind wesentliche Bestandteile der Fachanwaltstätigkeit im Bank- und Kapitalmarktrecht. Die gesetzlichen Grundlagen für Bankgeschäfte werden im Bankrecht festgelegt, welches sich jedoch nicht in einem spezifischen, einzelnen Gesetz finden lässt. Grundlagen für das Bankrecht finden sich im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB), im Handelsgesetzbuch (HGB), Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) oder in Steuergesetzen sowie in Strafvorschriften wieder. Es werden Rahmenbedingung zwischen Kunde und Bank/Sparkasse von der Kontoeröffnung über Beratung bis zur Beendigung der Geschäftsbeziehung geregelt.
Weitere Schwerpunkte sind Bestimmungen aus dem Bankaufsichtsrecht und zum Kreditsicherungsrecht, die darauf ausgelegt sind, den Anleger zu schützen. Im Kapitalmarktrecht werden Regelung zum Kapitalmarkt, insbesondere zum Wertpapierhandel an sich festgelegt. Im Wertpapiergeschäft wird der Handel mit Unternehmensanteilen in Form von Aktien oder Optionsscheinen, die das Recht auf den Kauf einer Aktie ermöglichen geregelt. Im Kapitalmarktrecht ist die Organisation der Kapitalmärkte und das Verhalten, der darin agierenden Marktteilnehmer festgelegt. Der Schutz der Anleger, der Wirtschaft und die Garantie der Funktionsfähigkeit der Kapitalmärkte werden unter anderem im Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) festgesetzt.
Finanz-MBA
Kernkompetenz neben der rechtlichen Beratung werden durch unsere Kanzlei im Consulting von Unternehmen abgebildet. Im Rahmen dessen bieten wir Ihnen eine umfassende Unternehmensberatung, mit der wir für jedes Problem Ihres Unternehmens bei Restrukturierung, Merger & Aquisition eine Lösung finden [...]
Grundlage dieser Unternehmensberatung ist neben der jahrlangen Berufserfahrung im Finanzdienstleistungssektor auch die branchenübergreifende Kenntnis der Masterausbildung (Master of Business Administration, MBA).
Wir können auf umfassende Kenntnisse in der Unternehmensführung, der Unternehmensstrategieentwicklung nebst Umsetzungsprozess, Unternehmensorganisation im Rechnungswesen, der Personalwirtschaft, der Revison, Unternehmensentwicklung- und steuerung zurückgreifen, die zuletzt über Jahre im Topmanagement einer Bank unter Beweis gestellt wurden. Finanzspezifisches Fachwissen aus dem Accounting, Controlling und Taxation gehören genauso zu Stärken wie Thematiken aus dem General Management.
Wir finden eine gemeinsame Lösung für Finanzierung- und Investitionsentscheidungen, suchen nach Potenzialen um Ihre Kostenstruktur zu optimieren, erschließen neue Märkte oder nehmen die Chance war, Ihr Unternehmen komplett neu auszurichten. Deferierte Schwachstellen nach einer umfangreichen IST-Analyse vor Ort und entwickle Lösungsstrategien, mit denen sich Ihr Unternehmen wieder wachstumsorientiert entwickeln kann. Dabei stehen wir Ihnen nicht nur im Problemfall als Unternehmensberatung mit Know How zur Verfügung, sondern greifen auch schon in der Planungsphase im Projektmanagement beratend ein, sodass Ihre Unternehmensführungsentscheidungen von Erfolg gekrönt sind und Risiken minimiert werden. Wir überwachen den im Anschluss folgenden Realisierungsprozess, beachten rechtliche Fragestellungen und übernehmen die Kontrolle der durchgeführten Einzelmaßnahmen.
Standort
Landeshauptstadt Erfurt
Meine Rechtsanwaltskanzlei ist im Zentrum des Freistaates Thüringen, in der Landeshauptstadt Erfurt, zu finden. Mit Eingemeindungen leben und fühlen sich in der Region 215.000 Menschen zu Hause. Erfurt gehört mit seinem historischen Altstadtkern, dem Erfurter Dom und der kulturellen Vielfalt zu einer der schönsten Städte Mitteldeutschlands. Die Kanzlei selbst ist etwas außerhalb im Ortsteil Frienstedt, in der Straße Ermstedter Erlen 62, zu finden. [...]
Das Bundesarbeitsgericht, die Universität Erfurt sowie die Fachhochschule Erfurt gehören neben den Ministerien des Freistaates zu den bedeutendsten Institutionen der Stadt. Europaweit gehört die Erfurter Universität zu einer der ältesten, deren bekanntester Stundet Martin Luther gewesen ist. Ende des 14. Jahrhundert wurde die Akademie das erste Mal urkundlich erwähnt, heute studieren ungefähr 5.000 Studenten an dieser Bildungsstätte, ähnlich wie an der Fachhochschule Erfurt. Neben dem Erfurter Dom mit der Severikirche ist die Altstadt mit weiteren 25 Kirchen und Kapellen versehen. Von der Zitadelle auf dem Petersberg ist der Stadtkern mit seinen zahlreichen Kirchtürmen wunderbar zu überblicken. Einheimische nutzen die Erhebung der Stadt beispielsweise zum Bestaunen des Silvesterfeuerwerkes oder zum Genießen des Weihnachtsmarktflairs in der Adventszeit. Bekannt ist die Altstadt hauptsächlich für die Krämerbrücke, auf der sich heute 32 Häuser befinden. Besucher finden Läden für Antiquitäten, Kunsthandwerker, kleine Cafés und Restaurants auf der Promenade. Die Brücke verbindet den Benedikts Platz und den Wenigemarkt und überspannt einen Seitenarm der durch Thüringen fließenden Gera. Das Bestehen der Brücke wird mit einem Stadtfest gefeiert, welches sich auf den ganzen Stadtkern verteilt. Das Krämerbrückenfest findet jährlich an einem Wochenende im Juni statt und ist neben dem Weihnachtsmarkt und Oktoberfest das bekannteste Fest der Stadt Erfurt. Kulturell ist das Theater Erfurt für die Ausrichtung der Erfurter Domstufenfestspiele bekannt. Jährlich wird ein neues Stück vor der Kulisse des Doms inszeniert. Das jedes Jahr neu gestaltete Bühnenbild ergibt mit dem hell erleuchteten Dom im Hintergrund ein wunderschönes Szenario. Der Erfurter Raum ist auch Wirtschaftsstandort für diverse Unternehmen aus dem Maschinen- und Anlagenbau, der Mikroelektronik und der Logistik. Die Anbindung zur A4 und A71 fördert den Wirtschaftsstandort Erfurt maßgeblich in der Logistik. Auf der Erfurter Messe präsentieren Unternehmen ihr Leistunsgsportfolio auf spezifischen Fachveranstaltungen oder Besucher genießen das Angebot von Veranstaltungen aus der Unterhaltungsbranche. 2021 ist die Bundesgartenschau zu Besuch in der Landeshauptstadt des Freistaates Thüringen. Schauplatz des Gartenbaus werden der Egapark Erfurt und die im Stadtkern befindliche Zitadelle Petersberg sein. Medienunternehmen wie der Mitteldeutsche Rundfunk, der Kinderkanal und die Mediengruppe Thüringen finden in Erfurt ebenfalls ein zu Hause.
Wegbeschreibung
Die Rechtsanwaltskanzlei ist sehr gut mit dem Auto, als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Es besteht eine unmittelbare Anbindung zur Autobahn A71, sodass Mandanten, die nicht aus der näheren Umgebung stammen, eine unkomplizierte Anfahrt auf sich nehmen können. Vom Stadtkern aus ist die Kanzlei mit der EVAG Straßenbahnlinie 2 Richtung Messe und im Anschluss mit der Buslinien 80 bequem zu erreichen. Parkmöglichkeiten sind im umliegenden Wohngebiet zahlreich vorhanden.
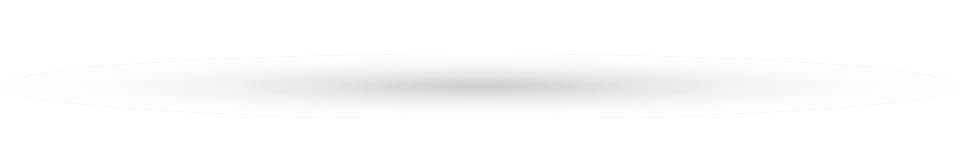
Rechtliche Spezialgebiete
Bank- und Kapitalmarktrecht
Kreditkunden, Kapitalanleger sowie Anlageberater und -vermittler sowie Banken vertrauen auf unsere in den vergangenen Jahrzehnten erworbene Expertise. Unser eigener Anspruch ist eine objektive unabhängige Rechtsberatung [...]
... mit Erfahrungshintergrund aus jahrelanger interner Branchenkenntnis verbunden mit unserem vorherrschenden Ziel einer wirtschaftlichen Interessenvertretung in ihrem individuellen Sinn. Als einer der wenigen Fachanwälte für Bank- und Kapitalmarktrecht in Thüringen und Vorsitzender des Fachausschusses für Bank- und Kapitalmarktrecht der Rechtsanwaltskammer Thüringen betreue ich schwerpunktmäßig Mandate, bei denen es sich um rechtliche Beziehungen innerhalb der Geschäftsverbindungen zwischen Bank und deren Kunden handelt. Die gesetzlichen Grundlagen für Bankgeschäfte werden im Bankrecht festgelegt, welches sich jedoch nicht in einem spezifischen, einzelnen Gesetz finden lässt. Grundlagen für das Bankrecht finden sich im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB), im Handelsgesetzbuch (HGB), Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) oder in Steuergesetzen sowie in Strafvorschriften wieder. Es werden Rahmenbedingung zwischen Kunde und Bank/Sparkasse von der Kontoeröffnung über Beratung bis zur Beendigung der Geschäftsbeziehung geregelt.
Bankvertragsrecht
Das Bankvertragsrecht beinhaltet das Recht der Geschäftsbeziehung zwischen Bank und Kunde, die Kontoführung und dessen Sonderformen, den Zahlungsverkehr, Kredit- und Debitkartengeschäft, sonstiges Kartengeschäft sowie das Internet-Banking oder Rechtsbeziehungen aus dem Leasing und Factoring.
Kreditvertragsrecht
Im Kreditvertragsrecht werden Rechtsverhältnisse aus Darlehen, Verbraucherkrediten sowie Baufinanzierungen genauso wie im Konsortial- und Avalkreditgeschäft beraten. Demgegenüber sind im Kreditsicherungsrecht Ansprüche [...]
... in aller Ausprägung zu Kündigungs- und Widerrufsrechten, Zwangsvollstreckungsrechten in Immobilien und Mobilien auch in ihren Sonderformen Beratungs- und Tätigkeitsschwerpunkt der Kanzlei. Gleichmaßen überprüfen wir in rechtlicher und finanzieller Hinsicht regelmäßig Ansprüche der Banken und Sparkassen auf Vorfälligkeitsentschädigung im Falle von Kündigungen oder Ablösungen von Kreditvertragsverhältnissen. In diesem Rechtsbereich kooperieren wir erfolgreich im Interesse unserer Mandanten mit dem Verlag für Rechtsjournalismus als fachkompetenter Partner über die Plattform: Vorfaelligkeitsentschaedigung.net
Kapitalmarktrecht
Im Kapitalmarktrecht werden Regelung zum Kapitalmarkt, insbesondere zum Wertpapierhandel an sich festgelegt. Im Wertpapiergeschäft wird der Handel mit Unternehmensanteilen in Form von Aktien oder Optionsscheinen geregelt [...]
Den Kern dabei bildet die Organisation der Kapitalmärkte und das Verhalten, der darin agierenden Marktteilnehmer. Der Schutz der Anleger, der Wirtschaft und die Garantie der Funktionsfähigkeit der Kapitalmärkte werden unter anderem im Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) geregelt. In diesem Rahmen bilden wesentliche Bestandteile der Fachanwaltstätigkeit der Wertpapierhandel, Termingeschäfte, die Vermögensverwaltung, der graue Kapitalmarkt, das Investment,- Depot- und Swapgeschäft, Prospektgeschäfte und Prospekthaftung genauso wie die private und betriebliche Altersversorgung.
Aufsichtsrecht
Die Geschäftsfelder im Interbankenverhältnis werden im Bank- und Kapitalmarktrecht genauso wie aufsichtsrechtliche, regulatorische und gesetzliche Anforderungen an Banken und Geschäftsleiter aus bankspezifischem Aufsichtsrecht [...]
... beraten und betreut. Das beinhaltet Erlaubnisverfahren für Banken und Geschäftsleiter, Rechte und Pflichten der Organe von Banken und Sparkassen, Regelungen zur Überwachung der Geschäftstätigkeit, Einhaltung bankrechtlicher Bestimmungen z.B. aus dem Gesetz über das Kreditwesen (KWG), Gesetz über die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-aufsicht, Groß- und Millionenkreditverordnung(GroMiKV), Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz (EAEG) oder den Mindestanforderungen an das Risikomanagement(MaRisk).
Vergütung
Welche Kosten entstehen bei Beauftragung?
Die häufig gestellte Frage der Vergütung, bei der Inanspruchnahme rechtsanwaltlicher Hilfe, kann nicht einheitlich und pauschal beantwortet werden. Die Grundlage unserer Kostenabrechnung wird durch das Rechtsanwaltsvergütungsgesetzt (RVG) verbindlich geregelt, bei dem der Streitwert die Honorarbezifferung anhand einer Gebührentabelle gesetzlich festlegt. Im Einzelfall kommt eine Gebührenvereinbarung in Betracht [...]
Gern erkläre ich Ihnen vor Mandatserteilung, im Rahmen eines vertraulichen Gespräches, welche gerichtlichen aber auch außergerichtlichen Kosten bei der Beauftragung bzw. bei Verfahrenseröffnung entstehen können, sodass Ihnen die Entscheidung obliegt, ob eine juristische Auseinandersetzung für Sie in Frage kommt. Ich werde Sie umfassend informieren und eine erste Risikoanalyse abgeben, die Sie bei der Entscheidungsfindung unterstützt. Falls Sie eine Rechtsschutzversicherung besitzen, setzen wir uns als Kanzlei auch direkt mit Ihrem Versicherer in Verbindung, sodass geprüft werden kann, welcher Kostenrahmen durch Ihre Versicherung gedeckt ist. Unabhängig vom RVG kann die Abrechnung auch über eine individuelle Honorarvereinbarung erfolgen, die ich Ihnen in einem detaillierten persönlichen Gespräch erläutere.
Blog
Verwahrentgelte / Negativzinsen der Banken und Sparkassen
Das Niedrigzinsniveau beschäftigt nicht nur die Wirtschaft, sondern insbesondere die Banken und Sparkassen und zunehmend auch deren Kunden. Im Anlagegeschäft der Kunden wird von Bedeutung, ob bestehende Zinszahlungspflichten bei variablen Produkten dazu führen, dass ein negativer Referenzzinssatz an den Kunden „durchgereicht“ werden kann, nachdem die EZB die Einlagenfazilität mit aktuell -0,5 % bestimmt hat.
Fraglich bleibt im Kundengeschäft der Bank/Sparkasse allein, ob dies automatisch geschehen kann oder ob es vereinbart werden muss.
Produktspezifizierung
Auf Kundeneinlagen erscheint die Vereinbarung von Verwahrentgelte bzw. Negativzinsen rechtlich zunächst grundsätzlich möglich. Für Spareinlagen und Altersvorsorgeverträge nach dem Altersvermögensgesetz bestehen hier Ausnahmen, die eine Vereinbarung von negativen Zinsen/Verwahrentgelten nicht zulassen. In rechtlicher Hinsicht ist bei negativen Zinsen und Verwahrentgelten zwischen Einlagenkonten (Tagesgelder, Geldmarktkonten) einerseits und Sichteinlagen mit Zahlungsverkehrsfunktion wie Girokonto andererseits zu unterscheiden.
Girokonten
Girokonten dienen primär der Abwicklung des Zahlungsverkehrs. Ist ein entsprechendes Guthaben vorhanden, dient es zumindest auch der unregelmäßigen Verwahrung des Guthabens. Das Girokonto stellt rechtlich einem Zahlungsdienste-Rahmenvertrag, sowie einen unregelmäßiger Verwahrvertrag gemäß § 700 BGB dar, der gemischt aus Verwahrungs- und Darlehenselementen besteht. Bei Girokonten stand bis dato für das Kreditinstitut das Darlehenselement im Vordergrund. Der unregelmäßigen Verwahrung von Konten kam eher eine geringe Bedeutung zu. Der Bankkunde gibt in rechtlicher Hinsicht dem Institut ein Darlehen. Aufgrund der langanhaltenden Niedrigzinsphase haben die Banken inzwischen kein Interesse mehr an erheblicher Liquidität, die Ihnen vom Sparer erbracht wird und ursprünglich auch der Finanzierung des Aktivgeschäfts (Kreditvergabe) der Banken diente. Die Einlagen sind in der Regel vom Einlagensicherungssystem der Banken und Sparkassen gedeckt, wodurch das Interesse der Verwahrung in heutige Zeit eine weit größere Bedeutung zukommen kann, was eine Vergütungspflicht angemessen erscheinen liese.
Voraussetzung dafür ist die Vereinbarung eines entsprechenden Kontoführungsentgelt oder Verwahrentgeltes im Rahmen einer ausdrücklichen Vereinbarung mit den Kunden. Bei Neukontoeröffnung kann eine solche Vereinbarung formularmäßig in Allgemeinen Geschäftsbedingungen und/oder Sparbedingungen getroffen werden. Im Falle von Bestandskonten geht das jedoch so einfach nicht. Nach Kundeninformation über die Marktsituation des Zinsniveaus müsste eine ausdrückliche Vereinbarung der Parteien über die Negativzinsen/Verwahrentgelte getroffen werden. Bei Girokonten kann ein Verwahrentgelt ferner zusätzlich zum Kontoführungsentgelt nach der Rechtsprechung eine unzulässige „Doppelbepreisung“ darstellen.
Einlagengeschäft
Die Vertragsbeziehung bei Sichteinlagen, insbesondere Guthaben auf Geldmarkt- und Tagesgeldkonten, wird rechtlich als unregelmäßiger Verwahrvertrag nach § 700 BGB angesehen. Unkritisch sind im Neukundengeschäft dementsprechende Vereinbarungen der Parteien. Im Bestandskundengeschäft hingegen bestünde die Möglichkeit Altverträge ordentlich zu kündigen und den Kunden ein neues Vertragsangebot zu unterbreiten oder einen abgeänderten Vertrag mit den Bestandskunden abzuschließen. Liegt beides nicht vor wäre das Verlangen nach Negativverzinsung unrechtmäßig.
Sparbücher
Ein Sparbuch ist eine urkundlich verbriefte unbefristete Einlage mit Kündigungsfrist von in der Regel 3 Monaten, also kann man von einem „umgekehrten Darlehen“ sprechen, bei dem der Bankkunde dem Institut ein Darlehen in Höhe der Spareinlage gewährt, weshalb es sich beim Sparvertrag nach Rechtsprechung und Literatur um einen Darlehensvertrag und nicht um eine Verwahrung nach § 700 BGB handelt, was negative Zinsen nicht ermöglicht, da im Darlehensrecht bereits nach dem Wortlaut von einer Zinszahlungspflicht des Darlehensnehmers ausgegangen wird. Ein Verwahrentgelt kommt nicht in Betracht, da die Regelungen der (unechten) Verwahrung bei einem Sparbuch keine Anwendung finden. Im Sparkassensektor kommt der Umstand hinzu, dass die Sparkassengesetze der Länder einen Auftrag der Sparkassen zur Bereitstellung von Möglichkeiten zur Ersparnisbildung verpflichtet, die durch Negativzinszahlungspflichten für Spareinlage unterlaufen werden könnte.
EuGH-Urteil zum Widerruf / Widerrufsjoker
Nach einem EuGH-Urteil vom 26. März 2020 können viele Verbraucher den Widerrufsjoker einsetzen und damit Darlehen und Autokredite widerrufen. Die Entscheidung lässt eine weitere Widerrufswelle der Kunden gegenüber den Banken und Sparkassen bevorstehen.
Vorteile für den Kreditnehmer ergeben sich im Kontext des Widerrufs aus den Möglichkeiten eine Vorfälligkeitsentschädigung zu ersparen, diese zurückzufordern oder aber aufgrund des aktuellen Zinsniveaus eine Umschuldung auf einen günstigeren Kredit mit geringeren Zinsen vornehmen zu können, oder auch ein belastetes und schwer verkäufliches Dieselauto zurückgeben.
Der Europäische Gerichthof entschied am 26.03.2020, dass der sogenannte Kaskadenverweis über § 492 Absatz 2 BGB nicht mit europarechtlichen Vorgaben der Verbraucherkreditrichtlinie 2008/48 vereinbar ist. Das Gericht eröffnet damit Verbrauchern die Möglichkeit, den Widerruf einzusetzen um ihre Immobilienfinanzierungsverträge oder Kfz-Finanzierungen zu widerrufen.
Im Falle eines Rechtsstreits gegen eine Sparkasse hatte sich das Landgericht Saarbrücken mittels eines Vorabentscheidungsersuchens an den EuGH gewandt und unter anderem zwei für die Widerrufsvoraussetzungen relevante Kernfragen vorgebracht:
1.)Ist Art. 10 Abs. 2 p der RL 2008/48 dahingehend auszulegen, dass zu den erforderlichen Angaben zur „Frist“ oder zu den „anderen Modalitäten für die Ausübung des Widerrufsrechts“ auch die Voraussetzungen für den Beginn der Widerrufsfrist gehören?
2.)Ist eine Widerrufsbelehrung hinreichend klar und prägnant, wenn sie hinsichtlich des Beginns der Widerrufsfrist erforderlichen Pflichtangaben nicht selbst vollständig benennt, sondern diesbezüglich auf eine nationalgesetzliche Vorschrift (vorliegend den § 492 Abs. 2 BGB) verweist, die ihrerseits auf weitere nationale Vorschriften (vorliegend Art. 247 §§ 6 bis 13 EGBGB) weiterverweist?
Widerrufsmodalitäten
Der EuGH kommt in seiner Beurteilung auf Grundlage des Art. 10 der Richtlinie 2008/48 der Europäischen Union über Verbraucherkreditverträge gegenüber den Banken und Sparkassen zu dem Ergebnis, dass nach Art. 10 Abs. 2 p der Richtlinie im Kreditvertrag in klarer und prägnanter Form nicht nur „das Bestehen oder Nichtbestehen“ eines Widerrufsrechts und „die Frist … für die Ausübung des Widerrufsrechts“ anzugeben sei, sondern vielmehr auch „die anderen Modalitäten für die Ausübung des Widerrufsrechts.“ Die Modalitäten für die Berechnung der Widerrufsfrist gehören demnach zu den Pflichtangaben des Kreditgebers, da angesichts der Bedeutung des Widerrufsrechts für den Verbraucherschutz die Information über dies Recht für den Verbraucher von grundlegender Bedeutung ist. Um von dieser Information vollumfänglich profitieren zu können, muss der Verbraucher im Vorhinein die Bedingungen, Fristen und Modalitäten für die Ausübung des Widerrufsrechts, genauso wie die Angaben zur Verpflichtung des Kreditnehmers zur Kapitalrückzahlung und der Zinszahlungsverpflichtung kennen.
Die Modalitäten zur Berechnung der Widerrufsfrist gehören damit zu den Informationen, die dem Verbraucher in klarer, prägnanter Form im Kreditvertrag durch das Kreditinstitut anzugeben sind.
Kaskadenverweisung
Auch in der zweiten Frage entscheidet der EuGH in seinem Urteil zugunsten der Verbraucher. Die zu beurteilenden Kreditverträgen reichen den Anforderungen des Gerichts aus der EU Richtlinie nicht, wenn die gegenständliche Kreditvertragsklausel einen Verweis zur Widerrufsinformationen auf § 492 Absatz 2 des BGB vornimmt, dieser wiederum lediglich auf Artikel 247 §§ 6 bis 13 EGBGB verweist, der wiederum auf weitere Bestimmungen des BGB verweist. Diesen sogenannten „Kaskadenverweis“ auf nationale Rechtsvorschriften hält der EuGH für nicht ausreichend um den Verbraucher in klarer, prägnanter Form über die Frist und die anderen Modalitäten für die Ausübung des Widerrufsrechts zu informieren.
Praxis der anwaltlichen Beratung
Konsequenzen des EuGH-Urteils für möglichen Widerruf
Das EuGH-Urteil bedeutet, dass jeder in der Zeit vom 11.06.2010 bis 20.03.2016 abgeschlossene Kredit eines Verbrauchers auf die Widerrufsmöglichkeit geprüft werden sollte und im Einzelfall ggf. widerrufen werden kann. Konkret geht es um die folgende Formulierung, die die Widerrufsinformationen fehlerhaft und damit den Einsatz des Widerrufsjokers möglich macht:
„Die Frist beginnt nach Abschluss des Vertrags, aber erst, nachdem der Darlehensnehmer alle Pflichtangaben nach § 492 Abs. 2 BGB (z.B. Angaben zur Art des Darlehens, Angaben zum Nettodarlehensbetrag, Angabe zur Vertragslaufzeit) erhalten hat.“
§ 492 Absatz 2 BGB verweist auf Artikel 247 §§ 6 bis 13 EGBGB und dieser wiederum verweist auf weitere Vorschriften. Damit handelt es sich um einen so genannten Kaskadenverweis. Der Verbraucher wird damit nicht ordnungsgemäß über sein Widerrufsrecht belehrt und kann nicht erkennen, unter welchen Voraussetzungen und wann genau die Widerrufsfrist zu laufen beginnt.
Der Widerruf eines Darlehens führt in der Folge zur Rückabwicklung des Kreditvertrages. Für Darlehen bedeutet dies, dass der Kreditnehmer sämtliche bereits geleistete Zahlungen einschließlich Zins- und Tilgungszahlungen zurück erhält die gegen die eigene Rückzahlung des Darlehens zu stellen ist.
Im Einzelfall kann man mit dem Kreditgeber auf Basis des aktuellen Zinsniveaus mit niedrigeren Zinsen umschulden. Auch kann durch den Widerruf eine Vorfälligkeitsentschädigung der Bank oder Sparkasse abgewendet werden, was eine Umfinanzierung wirtschaftlich ungleich attraktiver macht.
Der Widerruf scheitert nicht grundsätzlich an einer bereits erfolgten Rückführung des Darlehens und kann insoweit auch noch rückwirkend ausgeübt werden, was auch die Rückforderung von bereits gezahlten Vorfälligkeitsentgelten ermöglicht.
Der vom EuGH angedeuteten Übertragung dieser Rechtsprechung auf deutsche Immobiliendarlehensverträge, die grundpfandrechtlich besichert sind, ist der Bundesgerichtshof zwar entgegengetreten, dahingehend bleibt aber die Rechtsprechung abzuwarten.
Widerruf bei Autokrediten
Nach der EuGH-Entscheidung können auch von Verbrauchern im Zeitraum 11.06.2010 bis 26.03.2020 geschlossene Autokreditverträge widerrufen werden. Relevante Kfz-Finanzierungen der Autobanken haben häufig in ihren Widerrufsinformationen auf den § 492 BGB verwiesen.
Autokreditverträge und der zugehörige Kaufvertrag für das Fahrzeug sind in der Regel verbundene Verträge. Bei einer solchen wirtschaftlichen Einheit wird im Widerrufsfall beide Verträge – also auch der Kaufvertrag - rückabgewickelt. Auch Leasingverträge als weit verbreitete Finanzierungsform können dem Widerruf unterfallen. Bei durchgreifenden Widerruf erfolgt die Rückgabe des Fahrzeugs an die Bank gegen Erstattung alle bereits geleisteten Zahlungen wie Fahrzeuganzahlung, Leasingraten, Zins- und Tilgungsleistungen. Die Anrechnung einer Nutzungsentschädigung für die Kilometerlaufleistung des Fahrzeuges ist in der Rechtsprechung noch streitig und in Abhängigkeit des konkreten Vertragsdatums im Einzelfall zu beurteilen., wir prüfen diese und melden uns in Kürze bei Ihnen zurück.
Aktuelle Rechtsprechung
Zum Thema Arbeitsrecht
- Beweiswert erschüttert: Wer eine Online-AU ohne Arztkontakt nutzt, riskiert die fristlose Kündigung
- Halbgarer Arbeitsplatzwechsel: Dieselben Fähigkeiten an anderer Position erneut abzuverlangen, macht zweite Befristung hinfällig
- Kündigung trotz Betriebsübergangs? Neue Anschrift mit Bestandsmobiliar nicht zwangsläufig Zeichen für Fortführung des Betriebs
- Schwerer Vertrauensmissbrauch: Falsche Zeiterfassung im Öffentlichen Dienst zieht Kündigung nach sich
- Trotz hoheitlicher Aufgaben: Warum die Kündigung eines Konsulatschauffeurs vor deutschen Gerichten landete
Hätte der Angestellte in diesem Fall nicht an der falschen Stelle gegeizt, wäre ihm die Kündigung womöglich erspart geblieben. So aber musste sich das Landesarbeitsgericht Hamm (LAG) mit der Frage befassen, ob die online gekaufte Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU) in der Variante "ohne Arztgespräch" eine fristlose Kündigung rechtfertigen durfte. Das Gericht prüfte dabei auch, ob vorher eine Abmahnung nötig gewesen wäre.
Ein IT-Consultant, der seit 2018 im Unternehmen arbeitete, meldete sich für den Zeitraum vom 19. bis 23.08.2024 krank. Dafür nutzte er eine im Internet kostenpflichtig erstandene Bescheinigung, die der Anbieter in zwei Varianten anbot: einmal mit und einmal ohne Arztkontakt. Die Version "ohne Gespräch" war zwar günstiger, enthielt dafür aber auch einen umfangreichen Disclaimer, der Arbeitnehmern mit skeptischen Vorgesetzten die Premiumkrankschreibung empfahl. Doch es kam, wie es kommen musste: Der IT-Consultant entschied sich für die preiswertere der beiden Varianten. Das Dokument selbst sah nahezu aus wie der frühere Papiervordruck der Krankenkassen und enthielt persönliche Daten sowie den Vermerk "Erstbescheinigung". Als Arztnummer stand dort lediglich "Privatarzt". Die Firma versuchte später, die elektronische Meldung der Krankenkasse abzurufen, erhielt aber keine passende AU. Als die Personalabteilung erfuhr, dass die vorgelegte Bescheinigung möglicherweise nicht echt war, kündigte das Unternehmen dem Mann fristlos und vorsorglich ordentlich.
Das Arbeitsgericht hielt diese Kündigung zunächst für unwirksam, doch das LAG kam zu einem anderen Ergebnis und sah einen wichtigen Grund für eine sofortige Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Nach seiner Auffassung täuschte der Beschäftigte bewusst vor, seine Arbeitsunfähigkeit sei nach einem ärztlichen Kontakt bestätigt worden. Damit verletzte er seine Pflicht zur Rücksichtnahme und zerstörte das notwendige Vertrauen. Ob er tatsächlich arbeitsunfähig gewesen war, spielte dabei keine Rolle. Die Form der Bescheinigung konnte leicht den Eindruck erwecken, sie würde auf einem medizinischen Kontakt beruhen. Dem Beschäftigten selbst war klar, dass kein Arztgespräch stattgefunden hatte, und auch der Online-Anbieter machte deutlich, dass das Dokument nicht nach regulären medizinischen Standards erstellt worden sei. Das LAG sah deshalb den Beweiswert der Bescheinigung als erschüttert. Angesichts der Täuschung musste der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis nicht bis zum Ende einer Kündigungsfrist fortsetzen. Eine Abmahnung war nach Einschätzung des Gerichts in diesem Fall nicht erforderlich, weil der Vertrauensbruch zu schwer wog.
Hinweis: Online-AUs ohne Arztkontakt bergen das Risiko, als Täuschung gewertet zu werden. Wer eine solche Bescheinigung nutzt, riskiert die fristlose Kündigung. Entscheidend ist, dass für den Arbeitgeber ein falscher Eindruck entsteht.
Quelle: LAG Hamm, Urt. v. 05.09.2025 - 14 SLa 145/25
| zum Thema: | Arbeitsrecht |
(aus: Ausgabe 02/2026)
Nach Ansicht seiner Arbeitgeberin hatte ein Mitarbeiter in diesem Fall lediglich intern die Abteilungen gewechselt. Doch so schlüssig waren die Umstände nicht, die vor das Arbeitsgericht Köln (ArbG) führten. Weil der Mitarbeiter im Kinobetrieb gleich zweimal hintereinander befristet eingestellt und dann entlassen wurde, war nun zu prüfen, ob die zweite befristete Anstellung ohne Sachgrund überhaupt gültig war und somit auch die darauffolgende Kündigung.
Das Filmtheater stellte einen Beschäftigten zunächst von Ende August 2023 bis Ende August 2024 als Filmvorführer in Teilzeit ein. Zu seinen Aufgaben gehörten auch Moderationen und Vorbereitungen eines besonderen Filmformats. Fünf Tage nach Ablauf dieses Vertrags erhielt er einen neuen befristeten Vertrag als Teilzeitkraft im Marketing, ebenfalls für ein Jahr. Während dieser Zeit übernahm er gelegentlich wieder die vorherige Tätigkeit als Filmvorführer und Tätigkeiten im Service. Im April 2025 folgte schließlich eine fristlose Kündigung, die jedoch nur von einer von zwei Geschäftsführerinnen unterzeichnet war, obwohl laut Handelsregister beide gemeinsam zeichnen mussten. Der Beschäftigte wies die Kündigung daher zurück und machte geltend, dass die erneute Befristung sowieso unwirksam gewesen sei.
Das ArbG bestätigte zunächst, dass die fristlose Kündigung schon wegen der fehlenden Vollmacht nicht gültig war. Anschließend bewertete es die Befristung des zweiten Vertrags. Nach dem Gesetz ist eine Befristung ohne Grund nur dann zulässig, wenn vorher kein Arbeitsverhältnis mit demselben Arbeitgeber bestanden hat. Da der Beschäftigte bereits ein Jahr zuvor dort gearbeitet hatte, durfte der neue Vertrag nicht erneut ohne Sachgrund befristet werden. Die kurze Unterbrechung von wenigen Tagen änderte daran nichts. Auch die Aufgaben im Marketing unterschieden sich nach Ansicht des Gerichts nicht so deutlich von der früheren Tätigkeit, dass eine Ausnahme erlaubt gewesen wäre. Beide Stellen waren Teilzeitjobs und verlangten ähnliche Fähigkeiten. Damit galt die Befristung als unwirksam - das Arbeitsverhältnis lief unbefristet weiter.
Hinweis: Eine sachgrundlose Befristung ist nach einer Vorbeschäftigung beim selben Arbeitgeber grundsätzlich ausgeschlossen. Nur wenn die neue Tätigkeit völlig andere Qualifikationen verlangt, kann es Ausnahmen geben.
Quelle: ArbG Köln, Urt. v. 09.10.2025 - 12 Ca 2975/25
| zum Thema: | Arbeitsrecht |
(aus: Ausgabe 02/2026)
Eine neue Adresse unter selbem Namen, in die auch das bestehende Mobiliar gebracht wird, deutet augenscheinlich auf einen völlig üblichen Umzug hin. Doch heißt das bei einem Unternehmen automatisch auch, dass es willens ist, dort seinen Betrieb fortzuführen, obwohl es sich inmitten eines Insolvenzverfahrens befindet? Das Arbeitsgericht Herford (ArbG) prüfte nach, ob eine frische Adresse oder gar die Nutzung einer Marke zwangsläufig für eine Weitergabe des Betriebs spricht.
Im Unternehmen arbeitete seit langer Zeit eine Beschäftigte in der Auftragsbearbeitung, die zudem den Betriebsrat führte. Nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens am 31.03.2025 legten Leitung und Betriebsrat sofort fest, dass der Betrieb abgewickelt werden solle. Noch am selben Tag gingen mehrere Kündigungen heraus. Im Mai 2025 verschärfte sich die finanzielle Lage weiter, so dass Firma und Betriebsrat schriftlich beschlossen, die gesamte Produktion endgültig zu beenden. Die Beschäftigte gehörte zu 64 Betroffenen. Am 28.05.2025 kündigte das Unternehmen das Arbeitsverhältnis fristgerecht zum 31.08.2025. Die Beschäftigte meinte jedoch, der Betrieb sei nicht wirklich stillgelegt worden, und verwies auf eine neu genutzte Anschrift, einen Presseartikel zur Fortführung der Marke sowie das Abholen einzelner Möbelstücke. Für sie deutete dies darauf hin, dass die Tätigkeit an anderer Stelle weiterging.
Das ArbG sah das jedoch anders und hielt die Kündigung durchaus für zulässig. Nach seiner Einschätzung stand bereits lange vor der Kündigung fest, dass die Firma ihre Arbeit komplett einstellen werde. Zudem bestätigte ein unterschriebener Interessenausgleich, dass keine Produktion mehr stattfinden werde und lediglich noch die Abwicklung laufe. Die Räume waren bereits vollständig geleert, und da diese Angaben nicht bestritten wurden, galten sie als sicher. Ebenfalls stellte das Gericht klar, dass für einen Übergang an einer neuen Stelle eine wirtschaftliche Einheit im Kern bestehen bleiben müsse - und genau davon konnte hier keine Rede sein: Denn weder gingen zentrale Maschinen noch wesentliche Arbeitsbereiche oder größere Teile der Belegschaft über. Das Mitnehmen einzelner Dekorationsstücke oder Möbel spiele dabei keine Rolle. Die spätere Nutzung der Marke an einem anderen Ort reiche ebenfalls nicht aus. Die neue Anschrift erklärte sich laut Firma allein durch den auslaufenden Mietvertrag.
Hinweis: Ein Betriebsübergang setzt mehr voraus als neue Räume oder Markenrechte. Entscheidend ist, dass ein Betrieb im Kern weitergeführt wird. Ohne diesen Kern bleibt eine betriebsbedingte Kündigung möglich.
Quelle: ArbG Herford, Urt. v. 02.10.2025 - 3 Ca 418/25
| zum Thema: | Arbeitsrecht |
(aus: Ausgabe 02/2026)
Hier und da mal etwas mehr, das kann doch nicht so schlimm sein - oder? Was in der Küche möglich ist, sollte in Sachen Arbeitszeiterfassung tunlichst unterlassen werden. Ist eine bewusste Täuschung nachweisbar, so wie im Fall des Landesarbeitsgerichts Mecklenburg-Vorpommern (LAG), können falsch eingetragene Arbeitszeiten eine Kündigung rechtfertigen. In seinem Urteil legte das Gericht dar, welche Folgen ein bewusster Umgang mit unrichtigen Zeitangaben hat.
Eine Verwaltungsmitarbeiterin stand seit Anfang 2021 in einem Arbeitsverhältnis im öffentlichen Dienst. An einem Oktobermorgen im Jahr 2023 begab sie sich direkt von zuhause aus zu einem Termin in einem Ministerium. Der Weg dorthin war kurz und zu Fuß gut erreichbar. Laut Eintragungen im Wachbuch hielt sie sich dort etwas mehr als anderthalb Stunden auf. Danach ging sie zu ihrer Dienststelle und meldete sich erst gegen zehn Uhr im elektronischen Zeitsystem an. Kurz danach beantragte sie eine rückwirkende Änderung der Arbeitszeit, und zwar einen deutlich früheren Beginn des Arbeitstags. Der Dienstbeginn lag vor den Eintragungen im Wachbuch des Ministeriums. Zudem trug sie ab diesem Zeitpunkt eine Dienstreise wegen eines angeblichen Termins ein. Zunächst wurden diese Angaben auch akzeptiert. Wenige Tage später fragte die Führungskraft jedoch nach, welche Aufgaben in dieser Zeit erledigt worden seien. Daraufhin bat die Mitarbeiterin erneut um eine Änderung und erklärte, sich bei der Uhrzeit vertan zu haben. Die Arbeitgeberin sah darin jedoch keinen Irrtum, sondern eine bewusste Täuschung; sie sprach der Verwaltungsmitarbeiterin die ordentliche Kündigung aus.
Das LAG bestätigte diese Entscheidung. Nach Ansicht des Gerichts waren die Zeitangaben absichtlich falsch gemacht worden, um eine längere Arbeitszeit vorzutäuschen. Ein solches Verhalten verletzte die Pflicht zur korrekten Zeiterfassung schwer. Dabei spielte es keine Rolle, welches System zur Erfassung genutzt wurde. Entscheidend war allein das bewusste Täuschen. Eine vorherige Abmahnung hielt das LAG hier nicht für nötig, da das Vertrauen nachhaltig zerstört gewesen sei. Auch eine Weiterbeschäftigung bis zum Ende der Kündigungsfrist erschien dem Gericht unzumutbar.
Hinweis: Arbeitszeiten müssen korrekt und ehrlich erfasst werden. Absichtliche Falschangaben können den Arbeitsplatz kosten. Vertrauen gilt als zentrale Grundlage jedes Arbeitsverhältnisses.
Quelle: LAG Mecklenburg-Vorpommern, Urt. v. 09.09.2025 - 5 SLa 9/25
| zum Thema: | Arbeitsrecht |
(aus: Ausgabe 02/2026)
Allgemeinhin genießen Konsulatsmitarbeiter diverse Immunitäten und Privilegien, unter anderem auch die Befreiung von der Gerichtsbarkeit. Warum die Kündigung eines solchen Konsulatsangestellten überhaupt vor deutschen Gerichten verhandelt werden konnte, zeigt das Hessische Landesarbeitsgericht (LAG) auf. Außerdem prüfte es auch, ob die Beendigung des Arbeitsverhältnisses inhaltlich gerechtfertigt war.
Ein langjährig Angestellter eines Generalkonsulats arbeitete dort seit 1980 und war ab 1995 als Chauffeur für die Konsulatsleitung tätig. Neben den Fahrten erledigte er kleinere Aufgaben im Gebäude, etwa Botengänge oder Arbeiten im Archiv. Die Anweisungen für den Alltag kamen unmittelbar von der Generalkonsulin oder dem Generalkonsul. Im März 2022 erlitt der Beschäftigte einen Unfall und fiel für längere Zeit aus. Nach der Behandlung stellte die Klinik fest, dass er künftig nicht mehr fahren könne, ihm andere leichte Tätigkeiten aber möglich seien. Am 19.09.2022 ging ihm ein Schreiben des Konsulats zu, das sein Arbeitsverhältnis zum 30.04.2023 enden lassen sollte. Die Begründung lautete, dass seine Hauptaufgabe künftig wegfiele und es im Konsulat keinen passenden Ersatzplatz gäbe. Der Beschäftigte hielt die Beendigung inhaltlich für fehlerhaft und führte an, dass nicht eindeutig feststehe, wer die Kündigung unterschreiben dürfe, und er weiterhin Aufgaben im Haus übernehmen könne.
Die Kündigungsschutzklage wies zuerst das zuständige Arbeitsgericht (ArbG) in Frankfurt am Main ab. Zur Frage, ob deutsche Gerichte hierfür überhaupt zuständig seien, war das ArbG der Ansicht, dass sich das Land mangels hoheitlicher Tätigkeiten des Chauffeurs nicht habe auf die Staatenimmunität berufen können. Die Kündigung selbst hielt das ArbG für sozial gerechtfertigt und somit für wirksam. Dagegen wehrte sich der Entlassene.
Doch auch das LAG blieb im Generellen bei der Sichtweise der Vorinstanz. Zwar widersprach es den Kollegen dahingehend, dass der Mann durchaus hoheitliche Tätigkeiten ausgeführt hatte und sich seine Arbeitgeberin somit auch auf die Staatenimmunität hätte berufen können. Dass der Fall dennoch in die deutsche Gerichtsbarkeit fiel, war schlicht und einfach der Tatsache geschuldet, dass das Konsulat am Verfahren teilnahm, ohne sich auf Staatenimmunität zu berufen. Dadurch galt dieser Schutz als aufgegeben. Inhaltlich half das dem Gekündigten jedoch nicht. Denn auch das LAG stellte fest, dass der Mann dauerhaft nicht mehr als Fahrer arbeiten konnte und damit ein personenbedingter Grund vorlag, ihm zu kündigen. Für eine Weiterbeschäftigung hätte ein freier, sinnvoller Arbeitsplatz bestehen müssen. Da es eine solche Stelle jedoch nicht gab und der betreffende Staat keinen neuen Arbeitsplatz einrichten musste, blieb die Kündigung wirksam.
Hinweis: Eine Staatenimmunität entfiel hier deshalb, weil das Konsulat sich ohne Einwand auf das Verfahren einließ. Für eine Weiterbeschäftigung reicht es hingegen nicht aus, dass früher einzelne Nebenaufgaben übernommen wurden. Entscheidend ist, ob ein geeigneter freier Arbeitsplatz vorhanden war.
Quelle: Hessisches LAG, Urt. v. 01.08.2025 - 10 SLa 86/25
| zum Thema: | Arbeitsrecht |
(aus: Ausgabe 02/2026)
Zum Thema Familienrecht
- Aufwandspauschale statt Betreuervergütung: Wer als Berufsbetreuer die Registrierung gemäß BtOG ignoriert, muss starke Einbußen in Kauf nehmen
- Namensrecht und Persönlichkeitsrecht: Tochter darf Geburtsnamen der verstorbenen Mutter annehmen, den diese nach der Scheidung wieder trug
- Namensungleichheit durch Patchwork: Den Namen des Stiefvaters als neuen Familiennamen anzunehmen, dient dem Kindeswohl
- Tatsachengrundlage beim Sorgerecht: Ausländische Sorgerechtsentscheidung kann auch ohne Anhörung des Kindes anerkannt werden
- Trennungsjahr und Unzumutbarkeit: Wer sich auf die Härtefallregelung stützen will, sollte unmittelbar handeln
Wurde eine natürliche Person vor dem 01.01.2023 als Berufsbetreuer bestellt, musste sie sich ab dem 01.07.2023 nach dem Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG) registrieren lassen. Tat sie dies nicht, setzte aber die Betreuung trotzdem über diesen Stichtag hinaus fort, war sie "nur" noch ehrenamtlicher Betreuer. Zu welchen Problemen das führen kann, zeigt dieser Fall vor dem Bundesgerichtshof (BGH).
Ein Betreuer wurde vor dem 01.01.2023 als Berufsbetreuer eingesetzt. Schon im Juni 2023 hatte er aus Altersgründen einen Betreuerwechsel angeregt, wurde aber erst im August 2023 aus seinem Amt entlassen. Er hat also seine Betreuungsleistung über den 30.06.2023 hinaus fortgeführt, ohne sich nach dem BtOG registriert zu haben. Als er nach seiner Entlassung seine Betreuervergütung abrechnen wollte, wurde ihm diese nur bis zum 30.06.2023 gewährt. Vom 01.07. bis zum 24.08.2023 erhielt er indes nur eine Aufwandspauschale. Er legte Rechtsbeschwerde bis zum BGH ein - leider ohne Erfolg.
Der BGH war hier bezüglich einer anderen Bewertung schlichtweg machtlos, da seit dem 01.01.2023 für die vergütungsrechtliche Einordnung nicht mehr die gerichtliche Feststellung der Berufsmäßigkeit, sondern allein jene nach dem BtOG gilt. Der Betreuer hatte keinen Registrierungsantrag gestellt, womit er ab dem 01.07.2023 nur noch als ehrenamtlicher Betreuer galt. Ein ehrenamtlicher Betreuer hat jedoch keinen Anspruch auf Vergütung und kann lediglich eine Aufwandspauschale verlangen. Diese konnte auch ohne ausdrücklichen Antrag festgesetzt werden.
Hinweis: Gerade im Betreuungsrecht kommt es häufiger zu Änderungen. Als Betreuer sollten Sie diese immer beachten, da Sie sonst Nachteile erfahren können - wie der Betreuer im Fall, der einen finanziellen Nachteil erlitt.
Quelle: BGH, Urt. v. 22.10.2025 - XII ZB 80/25
| zum Thema: | Familienrecht |
(aus: Ausgabe 02/2026)
Möchte ein volljähriges Kind seinen Geburtsnamen neu bestimmen lassen, benötigt es hierzu die Einwilligung des Elternteils, dessen Namensänderung es sich anschließen möchte. Was aber passiert, wenn diese Einwilligung gar nicht mehr erteilt werden kann, zeigt dieser Fall des Amtsgerichts Köln (AG).
Eine Frau wollte den Geburtsnamen ihrer im Jahr 2012 verstorbenen Mutter annehmen. Seit Geburt trug die Frau zwar den Ehenamen ihrer Eltern als Geburtsnamen, nach der Scheidung hatte die Mutter jedoch ihren Geburtsnamen wieder angenommen. Und eben diesen wollte die Tochter nun auch annehmen. Das Standesamt bezweifelte jedoch, ob dies ohne Einverständniserklärung der toten Mutter überhaupt möglich ist.
Das AG konnte diese Unsicherheit nun ausräumen: Die Tochter darf ihren Namen wunschgemäß ändern lassen. Das volljährige Kind kann sich einer Namensänderung eines geschiedenen oder verwitweten Elternteils durch eigene Erklärung gegenüber dem Standesamt anschließen. Die Möglichkeit der Neubestimmung des Geburtsnamens ist dabei an keine Frist gebunden. Zwar kann die Neubestimmung des Geburtsnamens nur mit Einwilligung des Elternteils, dessen Namensänderung das volljährige Kind folgt, durchgeführt werden. Zur Wahrung des Persönlichkeitsrechts dieses Elternteils soll ihm das Kind schließlich nicht gegen seinen eigenen Willen namentlich zugeordnet werden. Ist der Elternteil - wie hier - hingegen bereits verstorben, kann sich das volljährige Kind auch ohne diese Einwilligung anschließen. Die Namensrechte des verstorbenen Elternteils spielen dann nämlich keine Rolle mehr.
Hinweis: Keine Regel ohne Ausnahme! Es ist schlicht auch nicht erkennbar, welchen Schaden die tote Mutter davon hätte, dass ihre Tochter ihren Namen annimmt. Grundsätzlich ist es in der Rechtsprechung die Regel, dass die Namensrechte von Verstorbenen weitaus weniger Beachtung finden als deren Rechte zu Lebzeiten.
Quelle: AG Köln, Beschl. v. 28.11.2025 - 378 III 98/25
| zum Thema: | Familienrecht |
(aus: Ausgabe 02/2026)
Seit dem 01.05.2025 gilt in Deutschland ein neues Namensrecht. Dieses gibt Betroffenen nicht nur mehr Freiheit bei Doppelnamen für Ehepaare und Kinder; es erleichtert zudem Stief- und Scheidungskindern die Namensänderung. Wenn es dem Kindeswohl diene, sollten diese Erleichterungen dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main (OLG) zufolge auch in Altfällen gelten, also in Fällen aus der Zeit vor dem 01.05.2025. Der von dem OLG hierzu entschiedene Fall zeigt klar auf, warum.
Die Eltern eines Mädchens hatten sich bereits vor dessen Geburt getrennt. Als Familiennamen erhielt das Kind die Geburtsnamen der Mutter und des portugiesischen Vaters. Von Geburt an hatte nur die Mutter das alleinige Sorgerecht. Kontakt zum Vater gab es nur sehr selten, gegen ihn wurden dafür aber häufig Gewaltschutzanordnungen erlassen. Dann lernte die Mutter einen neuen Mann kennen und heiratete ihn. Aus dieser Beziehung ging ein Sohn hervor. Nun wollte die Mutter, dass auch die Tochter den Namen des neuen Ehemanns annimmt, der leibliche Vater aber stimmte diesem Wunsch nicht zu. Deswegen beantragte die Mutter, die Einwilligung des Vaters in die sogenannte "Einbenennung" gerichtlich ersetzen zu lassen.
Das OLG hörte die Eltern des Kindes an und holte zudem ein Sachverständigengutachten zu den Auswirkungen der Namensungleichheit ein. Die Zustimmung des leiblichen Vaters wurde schließlich ersetzt. Die Mutter konnte sich mit ihrem Wunsch nach der Namensänderung also durchsetzen. Zwar hatte die Mutter den Antrag auf Ersetzung der Zustimmung des Vaters gestellt, als die alte strengere Rechtslage noch galt. Trotzdem konnte das Gericht hier nach der neuen Rechtslage entscheiden, weil das dem Kindeswohl diente. Es verstieß dabei auch nicht gegen das Rückwirkungsverbot, da die Namensänderung schließlich nur für die Zukunft gilt.
Hinweis: Auch bei Altfällen können Sie sich also auf die aktuellen Namensregelungen berufen, sobald dies dem Wohl Ihres Kindes dient. Dies ist auch nachvollziehbar, denn erst dadurch, dass das Mädchen in diesem Fall den gleichen Namen trägt wie Mutter, Stiefvater und Halbbruder, wird auch nach außen gezeigt, dass es sich um eine Familie handelt. Das Mädchen mag aus einer früheren Beziehung stammen, gehört aber jetzt auch zur neuen Familie dazu.
Quelle: OLG Frankfurt am Main, Beschl. v. 28.11.2025 - 2 WF 115/25
| zum Thema: | Familienrecht |
(aus: Ausgabe 02/2026)
Die Welt ist mobil, und innerhalb der EU herrscht Freizügigkeit. Das führt wiederum auch dazu, dass Menschen mitsamt ihrer Geschichte umziehen, also auch mit ausländischen Sorgerechtstiteln, die dann in Deutschland anerkannt werden müssen. Ein solcher Fall schaffte es vor kurzem bis vor den Bundesgerichtshof (BGH).
Die Eltern eines im Februar 2015 geborenen Kindes lebten in der bulgarischen Hauptstadt Sofia. Als die Eltern sich scheiden ließen, erließ das dortige Amtsgericht einen Beschluss, mit dem die Scheidung der Ehe ausgesprochen und die elterliche Sorge für das Kind dem Vater übertragen wurde. Umgangskontakte zwischen der Mutter und dem Kind wurden aber festgelegt. Kurze Zeit nach dieser Entscheidung verließ die Mutter mit dem Kind Bulgarien und zog nach Berlin. Der Vater erhielt eine "Vollstreckbare Ausfertigung" der Sorgerechtsentscheidung, die die Anordnung enthält, dass die Kindesmutter das betroffene Kind unverzüglich an den Kindesvater herauszugeben habe. Diese Sorgerechtsentscheidung wurde in Deutschland anerkannt. Die Mutter legte Beschwerde ein, da man hierzu das Kind nicht angehört hatte.
Der BGH gab hingegen dem Vater Recht. Denn nach Europarecht werden die in einem Mitgliedstaat ergangenen Entscheidungen grundsätzlich in den anderen Mitgliedstaaten anerkannt, ohne dass es hierfür eines besonderen Verfahrens bedarf. Eine explizite Entscheidung über die Anerkennung kann aber auch beantragt werden, wenn eine Partei hieran ein Interesse hat, wie eben der Kindsvater am Sorgerecht für sein Kind. Die mangelnde Anhörung des Kindes kann durchaus ein Anerkennungshindernis sein. Hier jedoch hatte das bulgarische Gericht eine ausreichende Tatsachengrundlage für seine Entscheidung, auch wenn es das Kind nicht angehört hatte.
Hinweis: Kinder sollen grundsätzlich angehört werden, wenn Entscheidungen ergehen, die sie betreffen. Davon kann aber abgesehen werden, wenn eine Anhörung tatsächlich unmöglich ist. Dies kann der Fall sein, wenn der Aufenthaltsort des Kindes unbekannt ist oder wenn das Gericht auch ohne Anhörung ausreichend Material hat, um sachgerecht zu entscheiden. Letzteres war hier anscheinend auch der Fall.
Quelle: BGH, Beschl. v. 03.12.2025 - XII ZB 169/25
| zum Thema: | Familienrecht |
(aus: Ausgabe 02/2026)
Möchten sich Eheleute scheiden lassen, müssen sie ein Trennungsjahr einhalten. Nur in besonderen Fällen kann eine Härtefallscheidung dieses Jahr hinfällig machen und eine sofortige Scheidung ermöglichen. Dazu muss die Fortführung der Ehe für den einen Ehegatten aber nachweislich unzumutbar sein. Ob dies im Folgenden der Fall war, musste das Oberlandesgericht Karlsruhe (OLG) prüfen und bewerten.
Der Vater war mutmaßlich betrunken nach Hause gekommen und soll die gemeinsame, damals sechsjährige Tochter im Intimbereich angefasst haben. Zudem verlangte er von ihr, ihn unsittlich zu berühren - wohl nicht der erste Vorfall dieser Art. Auch eine Freundin der Mutter soll der Mann unerwünscht angefasst haben. Zudem hatte er seiner Ehefrau bereits das Nasenbein gebrochen. Kurz nach dem Vorfall mit dem Kind zog der Mann schließlich aus. Rein formal begann das Trennungsjahr somit am 18.01.2025. Ende Januar 2025 beantragte die Mutter vor Gericht die Härtefallscheidung. Damit kam sie aber nicht durch.
Das OLG begründete die Ablehnung der Härtefallscheidung wie folgt: Der Bruch des Nasenbeins konnte keine unzumutbare Härte mehr begründen, da sich dieser Vorfall bereits vor 15 Jahren ereignet hatte. Das sei für eine jetzige Härte schlichtweg zu lange her, zudem hatten sich die Eheleute im Anschluss auch wieder versöhnt. Da sich die Frau nach dem Vorfall mit ihrer Freundin ebenfalls nicht von ihrem Mann getrennt hatte, hat sie auch diesen Übergriff offenbar toleriert. Weitere Übergriffe konnten nicht überzeugend geschildert werden. Anders verhielt es beim sexuellen Übergriff auf die gemeinsame Tochter - diesen hatte der Ehemann in einer SMS an seine Frau quasi selbst eingeräumt. Aus diesem Übergriff, der ja auch strafbar ist, kann aber auch kein Härtefall konstruiert werden. Die Ehe sei "nur" gescheitert. Zudem war es hier so, dass die Eheleute sich getrennt hatten und kein Kontakt zwischen Vater und Tochter mehr bestand. Deswegen sei es der Mutter zumutbar, die restlichen zwei Monate des Trennungsjahres noch auszuhalten.
Hinweis: Wenn Sie sich auf einen Härtefall stützen wollen, sollten Sie stets unmittelbar agieren. Je länger ein Verhalten Ihrerseits folgenlos bleibt und damit augenscheinlich toleriert wird, desto schlechter können Sie die Unzumutbarkeit für sich behaupten. Außerdem spielt es bei der gerichtlichen Entscheidung auch eine Rolle, wie viel Zeit des Trennungsjahres noch vor Ihnen liegt. Im Fall waren die "letzten zwei Monate" für die Frau auszuhalten, vielleicht aber hätte das Gericht anders geurteilt, wenn es noch sechs oder sieben Monate gewesen wären. Je schneller Sie also handeln, desto mehr "Härtefaktoren" können Sie für sich anführen und damit Ihre Erfolgschancen verbessern.
Quelle: OLG Karlsruhe, Beschl. v. 26.12.2025 - 5 UF 151/24
| zum Thema: | Familienrecht |
(aus: Ausgabe 02/2026)
Zum Thema Mietrecht
- Bad darf Bad bleiben: Geräuschbelastung durch Abwasserrohre führt nicht zu Rückbauanspruch zur Küche
- Ermessenspielraum beim Wirtschaftsplan: Beschluss der Wohnungseigentümergemeinschaft nur bei klaren Fehlern anfechtbar
- Lebensplanung des Vermieters: Plausible Begründung reicht für Eigenbedarfskündigung aus
- Rechtliches Gehör verletzt: Gericht muss Hinweise zu unzumutbarer Härte bei Eigenbedarf ernst nehmen
- Räumungsklage wegen Eigenbedarfs: Keine nachträgliche Kostenübernahme durch den Sozialhilfeträger möglich
Dass Geräusche anderer stören können, weiß jeder, der nicht allein im Haus lebt. Und dass es Eigentümern damit nicht anders geht als Mietern, zeigt dieser Fall des Amtsgerichts Hamburg (AG). Hier störte sich der eine daran, dass der andere über ihm offensichtlich gerade das Bad nutzte, während er selbst womöglich gerade speiste. Wie das? Ganz einfach, weil der darüber wohnende Wohnungseigentümer seine Küche in ein Badezimmer umgewandelt hatte. Ob das so bleiben durfte, lesen Sie hier.
Die Parteien, die sich vor Gericht trafen, waren Mitglieder einer Wohnungseigentümergemeinschaft. Der Eigentümer einer Erdgeschosswohnung beklagte sich über erhebliche Geräusche aus dem Badezimmer der darüber liegenden Wohnung im dritten Obergeschoss. Dort hatte der Eigentümer 2019/2020 Bad und Küche getauscht, was dazu führte, dass Abwasserleitungen aus dem neuen Badezimmer direkt über der Küche des darunter wohnenden und nun klagenden Eigentümers verliefen, was beim Benutzen des Badezimmers laute Geräusche verursachte. Ein Beweisverfahren zeigte jedoch auf, dass die Rohre bereits bei Bau des Hauses nicht ausreichend schallgedämmt waren. Dennoch verlangte der Kläger, dass das Badezimmer zurückgebaut werde und die Abwasserleitungen so verändert werden, dass keine Geräusche mehr in seine Küche gelangen. Der Eigentümer der darüber liegenden Wohnung argumentierte, er habe das Badezimmer rechtmäßig eingerichtet und die Leitungen korrekt an das gemeinschaftliche Fallrohr angeschlossen.
Das AG wies die Klage ab. Nach Ansicht des Gerichts darf der störende Eigentümer selbst entscheiden, wie er eine Beeinträchtigung beseitigt, solange er das Maß der Zumutbarkeit nicht überschreitet. Ein Rückbau des Badezimmers in eine Küche sei hingegen nur dann erforderlich, wenn eben jener Rückbau die einzige ernsthafte Möglichkeit wäre, die Störung zu beseitigen. Hier gab es jedoch andere Lösungen - etwa den Austausch der Abwasserleitungen durch besser gedämmte Rohre. Der Rückbau des Badezimmers hätte die Lärmbelästigung zudem nicht vollständig beseitigt, da weiterhin Geräusche aus der Küche des darüberliegenden Eigentümers zu erwarten gewesen wären. Deshalb durfte der Eigentümer das Badezimmer bestehen lassen und musste nur die Leitungen entsprechend verbessern.
Hinweis: Eigentümer müssen Störungen im Rahmen der Zumutbarkeit verhindern, dürfen aber selbst entscheiden, wie sie Abhilfe schaffen. Ein Rückbau von Räumen ist nur dann nötig, wenn keine anderen Maßnahmen sinnvoll sind. Schalldämmung kann eine praktikable Alternative sein.
Quelle: AG Hamburg, Urt. v. 19.03.2025 - 9 C 184/24
| zum Thema: | Mietrecht |
(aus: Ausgabe 02/2026)
Eigentum verpflichtet und bindet, im Fall von Wohnungseigentümergemeinschaften auch an die gefassten Beschlüsse. Der Bundesgerichtshof (BGH) befasste sich im Folgenden mit der Frage, wann Wohnungseigentümer einen Beschluss über Vorschüsse für gemeinschaftliche Kosten anfechten können, obwohl diese offensichtlich weder deutlich zu hoch noch erkennbar zu niedrig angesetzt wurden und keinerlei Fehler erkennbar waren.
In einer Eigentümerversammlung im Jahr 2022 legte die Gemeinschaft fest, welche Vorschüsse die Mitglieder für das laufende Jahr zahlen sollen. Einer der Eigentümer hielt die Berechnungen jedoch für falsch und versuchte, den Beschluss gerichtlich kippen zu lassen. Sowohl das Amtsgericht als auch das Landgericht wiesen seine Klage ab.
Schließlich bestätigte auch der BGH diese Entscheidungen und erklärte, dass ein Wirtschaftsplan immer eine Schätzung darstelle. Darin müssen alle erwartbaren Ausgaben eines Jahres stehen, einschließlich der Beträge für Rücklagen oder regelmäßige Kosten. Ein solcher Plan solle sicherstellen, dass der Verwalter alle Rechnungen bezahlen könne. Die Eigentümer dürfen dabei selbst entscheiden, welche Posten sie aufnehmen und wie hoch die Beträge ausfallen. Dieses Ermessen ist bewusst weit gefasst. Erst wenn hier bereits bei der Beschlussfassung völlig klar gewesen wäre, dass die angesetzten Vorschüsse viel zu hoch oder deutlich zu niedrig waren, hätte der Beschluss angefochten werden können. Im vorliegenden Streit sah der BGH aber keinerlei Hinweise auf solche offensichtlichen Fehler. Die geplanten Positionen - etwa Ausgaben für Rechtsberatung, Gerichtsverfahren, die Anmietung einer Fahrradgarage oder die Rücklage für Reparaturen - wirkten auf das Gericht nachvollziehbar und angemessen. Daher blieb es beim ursprünglichen Beschluss der Gemeinschaft.
Hinweis: Streit über einen Wirtschaftsplan lohnt sich nur, wenn gravierende und eindeutig erkennbare Fehlkalkulationen vorlagen. Schätzungen und Prognosen machten die Pläne naturgemäß ungenau, waren aber trotzdem gültig. Eigentümer sollten daher genau prüfen, ob wirklich ein klarer Verstoß vorliegt.
Quelle: BGH, Urt. v. 26.09.2025 - V ZR 108/24
| zum Thema: | Mietrecht |
(aus: Ausgabe 02/2026)
Im folgenden Fall war wieder einmal der Hammer "Eigenbedarfskündigung" Anlass für Mieter und Vermieter, sich vor Gericht zu treffen. Und wieder einmal ging es dabei um den hart umkämpften Wohnungsmarkt in Berlin. Doch das vorerst letzte Wort hatte hier zunächst Karlsruhe, denn der Bundesgerichtshof (BGH) musste klären, wie weit Gerichte wie das Landgericht Berlin (LG) überhaupt in die Wohnplanung eines Vermieters eingreifen dürfen.
Die Mieterin lebt seit 2006 in ihrer Zweizimmerwohnung im dritten Stock. Der Eigentümer wohnte direkt darüber und wollte das Dachgeschoss zu Wohnraum ausbauen. Während der entsprechenden Umbauzeit wäre seine eigene Wohnung nicht nutzbar gewesen. Er kündigte daher das Mietverhältnis und erklärte, die Wohnung im dritten Stock zu benötigen. Nach dem Umbau wolle er dauerhaft dorthin umziehen und seine alte Wohnung verkaufen. Das Amtsgericht gab dem Räumungswunsch zunächst statt. Das LG hob diese Entscheidung jedoch auf, da es die Kündigung als missbräuchliche Verwertungskündigung ansah und es dem Eigentümer allein um den Verkauf, jedoch nicht um echten Eigenbedarf ginge.
Der BGH sah die Begründung jedoch als fehlerhaft an und schickte den Fall zur erneuten Prüfung zurück ans LG. Der BGH stellte klar, dass Eigenbedarf nicht erst dann vorliege, wenn ein Vermieter den Wohnraum dringend benötige. Vielmehr genüge es bereits, wenn nachvollziehbare Gründe für den Wunsch bestanden, eine vermietete Wohnung künftig selbst nutzen oder nahen Angehörigen zur Verfügung stellen zu wollen. Die Gerichte müssen diesen Wunsch grundsätzlich akzeptieren und dürfen nicht ihre eigenen Vorstellungen von einer passenden Wohnsituation an die Stelle der Lebensplanung des Vermieters setzen. Auch der Plan, die bisherige Wohnung aufzugeben oder zu verkaufen, ändere daran nichts. Selbst wenn ein Vermieter die Gründe für den Eigenbedarf selbst geschaffen habe, spricht das nicht automatisch gegen ihn. Das LG muss nun prüfen, ob die Gründe im konkreten Fall nachvollziehbar und ernst gemeint waren.
Hinweis: Eigenbedarf setzt keine Notlage voraus. Entscheidend sind nachvollziehbare Gründe und ein ernsthafter Nutzungswunsch. Gerichte dürfen Vermietern keine eigene Wohnvorstellung aufzwingen.
Quelle: BGH, Urt. v. 24.09.2025 - VIII ZR 289/23
| zum Thema: | Mietrecht |
(aus: Ausgabe 02/2026)
Berlin und der Eigenbedarf - was in der Stadt in Sachen Mietrecht durchdekliniert wird, lässt Gerichte in allen Ballungsräumen aufhorchen. Dass auf diesem Gebiet durchaus noch viel zu lernen ist, zeigt der folgende Fall, dessen Urteil vor dem Bundesgerichtshof (BGH) kassiert wurde. Denn hier ignorierte das vorinstanzliche Landgericht (LG) bei einer Eigenbedarfskündigung offensichtlich wichtige Eckpunkte bezüglich der in Anspruch genommenen Härtefallregelung.
Der Mieter (Jahrgang 1939) wohnte seit 1982 in einer Dreizimmerwohnung, als schließlich der Eigentümer wechselte und der neue Vermieter dem alten Herrn im Jahr 2021 wegen Eigenbedarfs kündigte. Der langjährige Bewohner erklärte, ein Umzug würde ihn psychisch und körperlich stark gefährden. Er verwies auf gesundheitliche Schäden, Depressionen, ein mögliches Suizidrisiko und eine schwere Herzerkrankung. Das Amtsgericht holte ein Gutachten ein - und entschied gegen ihn. Das LG bestätigte das Urteil, obwohl der Mieter weiterhin auf die Härtefallregelung pochte.
Der BGH hob diese Entscheidung nun auf, da dessen Ansicht nach das LG zentrale Punkte nicht ausreichend geprüft hatte. Das eingeholte Gutachten war nach Auffassung des BGH unklar, unvollständig und teilweise widersprüchlich. Trotzdem nutzte das LG Teile dieses Gutachtens zu Lasten des Mieters, während andere - für ihn günstigere - Feststellungen ohne weitere Rückfragen ignoriert wurden. Das Gericht hätte die offenen Fragen klären müssen, etwa die Auswirkungen eines Umzugs auf die psychische Stabilität, die Bedeutung der Herzprobleme und die Lebensumstände zwischen zwei Wohnorten. Stattdessen nahm das LG an, dass eine schwere Beeinträchtigung nicht zu erwarten sei, obwohl das Gutachten dazu keine verlässliche Grundlage bot. Damit war das rechtliche Gehör des Mieters verletzt, und die Sache muss erneut verhandelt werden.
Hinweis: Wenn Gutachten widersprüchlich oder unvollständig sind, müssen Gerichte nachfragen. Besonders bei Härtefällen dürfen gesundheitsbezogene Risiken eines Umzugs nicht einfach übergangen werden. Rechtliches Gehör bedeutet, dass alle relevanten Argumente berücksichtigt werden müssen.
Quelle: BGH, Urt. v. 26.08.2025 - VIII ZR 262/24
| zum Thema: | Mietrecht |
(aus: Ausgabe 02/2026)
Ob das Sozialamt die Kosten eines Räumungsverfahrens übernehmen muss, ist eine Frage, die das Landessozialgericht Hessen (LSG) entscheiden musste. Denn sobald der Sozialhilfeträger die übernommene Miete stets pünktlich bezahlt hat und die Räumungsklage sich folglich auch nicht auf verspätete Mietzahlungen stützt, wird es schwierig, hier auf Hilfe zu hoffen - vor allem nachträglich. Lesen Sie hier, warum.
Ein Mann, der seit vielen Jahren Sozialhilfe erhielt, lebte mehr als drei Jahrzehnte in seiner Wohnung. Die Stadt zahlte über all die Jahre hinweg regelmäßig die Miete. Als die neuen Eigentümer ihm wegen Eigenbedarfs kündigten, kam es zum Räumungsverfahren. Der Mann informierte die Stadt darüber und teilte dem Amt später ebenso mit, dass ihm das Gericht eine Räumungsfrist gesetzt hatte. Für das Gerichtsverfahren beantragte er keine Unterstützung und bezahlte die Kosten selbst. Später zog er um, und die Stadt übernahm die Umzugskosten. Die Kosten des Räumungsverfahrens wollte sie aber nicht erstatten. Der Mann legte Widerspruch ein und argumentierte, er habe wegen der schwierigen Wohnungssituation gar keine andere Wahl gehabt. Doch sowohl das Sozialgericht als auch das LSG gaben der Stadt recht.
Das LSG stellte fest, dass die Stadt die Miete stets vollständig gezahlt hatte; die Räumung hing daher nicht mit fehlenden oder verspäteten Leistungen zusammen. Entstehen nach einer ordnungsgemäß gezahlten Miete weitere Forderungen, seien diese nicht als neue Unterkunftskosten, sondern als Schulden zu werten. Solche Schulden dürften jedoch nur dann übernommen werden, wenn sie nötig seien, um eine Wohnung zu sichern oder eine Notlage zu verhindern. Das war hier aber nicht der Fall. Schließlich hatte der Mann die Kosten bereits beglichen, bevor er eine Übernahme beantragte. Deshalb lag auch keine Notlage vor, die das Sozialamt hätte abwenden müssen.
Hinweis: Wer Kosten eines Gerichtsverfahrens erstattet bekommen möchte, sollte vorher klären, ob ein Antrag auf Kostenhilfe möglich ist. Außerdem müssen Schulden grundsätzlich bereits bestehen, bevor das Sozialamt sie prüfen kann. Bereits bezahlte Beträge gelten nicht mehr als übernahmefähig.
Quelle: LSG Hessen, Urt. v. 27.08.2025 - L 4 SO 38/25
| zum Thema: | Mietrecht |
(aus: Ausgabe 02/2026)
Zum Thema Verkehrsrecht
- Kein rechts vor links: Ist eine Zuwegung zum Parkplatz als Ausfahrt erkennbar, trifft Ausfahrenden erhöhte Sorgfaltspflicht
- Klar sichtbares Schlagloch: Wenn auf Fotos ein Schaden klar erkennbar ist, ist er es auch für aufmerksame Verkehrsteilnehmer
- Sorgfaltspflichten bei Spurwechsel: Jegliches Überholen ist bei unklarer Verkehrslage unzulässig
- Trotz unfallfreier Praxis: Aufgedeckte Manipulation bei Theorieprüfung zieht Fahrerlaubnisentziehung nach sich
- Verkehrssicherungspflicht eingehalten: Auch Radfahrer trifft Pflicht für umsichtiges Fahrverhalten
"Hoppla, hier komm’ ich!", denken so einige Verkehrsteilnehmer und erwarten entsprechende Rücksichtnahme der anderen. Ein derart flapsiger Gedanke mag dem Kläger im folgenden Fall zwar nicht unterstellt werden - Fakt jedoch ist, dass er die Pflicht der anderen, sich ihm anzupassen, überschätzt hatte. Denn nach dem gegnerischen Versicherer war auch das Landgericht Lübeck (LG) der Auffassung, dass hier dem Falschen mangelnde Rücksichtnahme vorgeworfen wurde.
Ein Autofahrer verließ ein Parkplatzgelände und wollte nach links abbiegen. Sein Wagen befand sich noch im Bereich der Zuwegung zum Parkplatz, war aber schon zum Teil auf die Fahrbahn eingefahren, als von links ein anderes Fahrzeug kam und beide - wer hätte dies hier erwartet? - miteinander kollidierten. Ebenso zu erwarten war dann, dass der Ausfahrende Schadensersatz forderte. Der Bereich der Zuwegung müsse seiner Auffassung nach nämlich als Straßenteil gewertet werden, daher gelte schließlich auch rechts vor links. Die Versicherung war anderer Meinung und verweigerte die Zahlung.
Das LG gab der Versicherung recht, da es nach einem Ortstermin zu der Erkenntnis gekommen war, dass das sogenannte "äußere Gepräge" der Zuwegung nicht als Straße einzuordnen sei. Es sei vielmehr erkennbar, dass der Parkplatz seinem charakteristischen Aussehen zufolge allein dem Parken diene und keine Verbindung zu einer anderen Straße darstelle. Bei der Ausfahrt handelte es sich um eine Zufahrt zum dahinterliegenden Parkplatz. Das Parkplatzgelände war durch mit erhöhten Bordsteinkanten umfasste Grünstreifen abgegrenzt. Unterbrechungen dieser Umgrenzung ermöglichten das Ein- und Ausfahren an verschiedenen Stellen. Im Wesentlichen waren auf dem Parkplatz die Parktaschen auf dem Boden markiert, es fanden sich auch Abstellplätze für Einkaufswagen. Daher sei verkehrsrechtlich die Zuwegung dem Parkplatz zuzuordnen. Demnach muss nicht nur der Einfahrende erhöhte Sorgfaltspflicht beachten, sondern natürlich auch der Ausfahrende. Und eben dessen Klage wurde daher auch abgewiesen.
Hinweis: Für die verkehrsrechtliche Einordnung eines Verkehrswegs als Ausfahrt ist das Gesamtbild der äußerlich erkennbaren Merkmale entscheidend, insbesondere der Zweck und die Bedeutung für den Verkehr. Maßgeblich ist, ob der Verkehrsweg dem fließenden Verkehr dient oder nur dem Zugang zu einem Grundstück.
Quelle: LG Lübeck, Urt. v. 05.09.2025 - 5 O 132/25
| zum Thema: | Verkehrsrecht |
(aus: Ausgabe 02/2026)
Wer im Straßenverkehr seine Sinne nicht nur beisammenhält, sondern auch nutzt, kann Schäden oftmals klein halten oder gar vermeiden. Daher sind selbstverschuldete Unfälle auch besonders ärgerlich. Dann jedoch die Schuld bei anderen zu suchen, hilft nicht viel, wenn Gerichte wie das Landgericht Flensburg (LG) anhand vorgelegter Beweise den Kopf schütteln und von einem Autofahrer verlangte Schadensersatz- und Schmerzensgeldzahlungen ablehnen.
Man ahnt es: Einmal mehr ging es hier um eine gemutmaßte Verletzung der Verkehrssicherungspflichten. Was war passiert? Ein offenbar hungriger Autofahrer unterbrach seine Fahrt, um sich bei einem Imbiss einen Döner Kebab zu kaufen, und stellte seinen Kleintransporter bei dunklen und regnerischen Verhältnissen am Straßenrand ab. Direkt neben seiner Fahrertür befand sich ein größeres Schlagloch von etwa 20 x 50 cm Außenmaßen und mit einer Tiefe von ca. 6 cm, das aufgrund des Wetters mit Wasser gefüllt war. Er trat beim Aussteigen hinein, stürzte und zog sich einen Außenbandriss zu. Daraufhin forderte er von der Kommune Schadensersatz und Schmerzensgeld. Er war der Ansicht, dass die Kommune entweder vor Schlaglöchern hätte warnen oder sie verfüllen müssen. Es sei für ihn nicht erkennbar gewesen, dass eine Gefahrenstelle vorgelegen habe.
Das LG wies die Klage ab. Zum einen habe die Gemeinde nachgewiesen, dass die Straßen regelmäßig kontrolliert werden. Zum anderen habe der ortskundige Geschädigte selbst Fotos vorgelegt, auf denen das Schlagloch gut zu sehen ist, weil in näherer Entfernung eine Laterne stand. Zu beachten sei auch, dass der Geschädigte aus einem Kleintransporter mit Tritthilfe ausgestiegen sei. Er habe daher im Gegensatz zum Verlassen eines Pkw die Fläche unter sich sehen können. Eine Pflichtverletzung der Gemeinde sei daher nicht anzunehmen, der Geschädigte hätte besser aufpassen müssen. Ist eine Sturzstelle deutlich zu erkennen und reiht sie sich in weitere offensichtliche Schadstellen ein, ist zu erwarten, dass der entsprechende Bereich nur befahren und betreten wird, sofern dies gefahrlos möglich ist. Insbesondere muss man bei einem mit Wasser befüllten Schlagloch mit einer erheblichen Tiefe rechnen und entsprechend besondere Vorsicht walten lassen.
Hinweis: Die Straßenverkehrssicherungspflicht hat zum Inhalt, die öffentlichen Verkehrsflächen gefahrlos zu gestalten und zu erhalten, um den Gefahren zu begegnen, die den Verkehrsteilnehmern aus einem nicht ordnungsmäßigen Zustand der Verkehrsflächen drohen. Eine absolute Gefahrlosigkeit kann jedoch nicht gefordert werden. Der Verkehrssicherungspflichtige muss vielmehr nur diejenigen Gefahren ausräumen und erforderlichenfalls vor ihnen warnen, die für den Nutzer, der die erforderliche Sorgfalt walten lässt, nicht oder nicht rechtzeitig erkennbar sind und auf die er sich nicht oder nicht rechtzeitig einzurichten vermag.
Quelle: LG Flensburg, Urt. v. 08.08.2025 - 2 O 147/24
| zum Thema: | Verkehrsrecht |
(aus: Ausgabe 02/2026)
Bei Spurwechseln gilt besondere Vorsicht. Und dass das nicht nur für den Verkehrsteilnehmer gilt, der seine bisherige Spur verlassen will, zeigt dieser Fall des Oberlandesgerichts Celle (OLG). Denn hier lag im rechtlichen Sinne gar kein Spurwechsel vor, weil er nämlich abgebrochen wurde. Was das für die Schadensregulierung nach einer daraus resultierenden Kollision bedeutet, lesen Sie hier.
Die Klägerin - eine Versicherung - machte einen Anspruch nach einem Kaskoschaden geltend, der durch einen Verkehrsunfall auf einer Autobahn entstanden war. Die Versicherung behauptete, der Beklagte sei mit "überschießender" Geschwindigkeit an das Fahrzeug ihres Versicherungsnehmers herangefahren, habe dabei die Lichthupe betätigt und versucht, sich an dem Fahrzeug vorbeizudrängeln. Dadurch habe der Beklagte den Unfall verursacht. Der Beklagte behauptete seinerseits, der gegnerische Fahrer habe seinen Spurwechsel von der linken auf die mittlere Fahrspur abgebrochen, als er - der Beklagte - zum Überholen angesetzt habe. Der Pkw habe sich bereits zur Hälfte oder zu zwei Dritteln auf der mittleren Spur befunden. Es habe keinen Grund dafür gegeben, auf die linke Spur zurückzuschwenken. Kein weiterer Verkehrsteilnehmer hätte den Fahrer durch einen Fahrstreifenwechsel von der rechten auf die mittlere Spur dazu gezwungen.
Das OLG gab - wie bereits die Vorinstanz - der Klage der Versicherung jedoch statt. Unbestritten war, dass der bei ihr Versicherte den begonnenen Spurwechsel nach rechts abgebrochen hatte und wieder vollständig auf die linke Spur zurückgezogen sei. Es stand ebenfalls fest, dass der Beklagte mit deutlich höherer Geschwindigkeit auf das Geschehen zugefahren war und das vollständige Beenden des Spurwechsels nicht abgewartet hatte. Jedes Überholen bei einer unklaren Verkehrslage ist unzulässig - egal aus welchem Grund. Den Fahrer der Klägerseite trifft kein Mitverschulden. Dieser musste den begonnenen Spurwechsel abbrechen, als er bemerkte, dass dort ein weiteres Fahrzeug ebenfalls einen Fahrspurwechsel nach links von der rechten auf die mittlere Fahrspur vollzog und eine Vollendung des Fahrspurwechsels seinerseits von links zur mittleren Spur möglicherweise in einem Unfall enden würde. In dieser Situation war er angehalten, den Spurwechsel abzubrechen und auf der Fahrspur weiterzufahren, die er zuvor noch nicht vollständig verlassen hatte.
Hinweis: Eine Rücklenkbewegung stellt sich nach der Rechtsprechung nicht als eigenständiger Spurwechsel dar, sondern als Weiterfahrt auf dem ursprünglich befahrenen Fahrstreifen. Der Beklagte war verpflichtet, mit dem Überholvorgang so lange zu warten, bis der Spurwechsel vollständig abgeschlossen war.
Quelle: OLG Celle, Urt. v. 05.11.2025 - 14 U 66/25
| zum Thema: | Verkehrsrecht |
(aus: Ausgabe 02/2026)
Sich zu bewähren heißt, sich als geeignet bzw. als zuverlässig zu erweisen. Vor das Erlangen einer Fahrerlaubnis hat das Gesetz beispielsweise das erfolgreiche Bestehen sowohl der praktischen als auch der theoretischen Prüfung gestellt. Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg (OVG) musste im Folgenden klarstellen, dass sich ein erfolgreiches Bewähren im Straßenverkehr jedoch nicht auf eine jahrelang unauffällige Fahrpraxis bezieht, wenn die dafür notwendige Fahrerlaubnis einst unrechtmäßig erlangt wurde.
Eine 1999 geborene Frau war jahrelang im Besitz einer Fahrerlaubnis, die sie durch eine Manipulation der theoretischen Prüfung erlangt hatte. Nachdem sie seinerzeit dreimal durch die theoretische Prüfung gefallen war, schickte sie beim vierten Versuch eine ihr ähnlich aussehende Person, die an ihrer statt die Prüfung schließlich auch bestand. Praktisch war es um die hier Beklagte besser bestellt, und so wurde ihr nach erfolgreicher praktischer Prüfung die Fahrerlaubnis ausgestellt. Mit dieser nahm sie jahrelang unauffällig am Straßenverkehr teil, bis der damalige Vorgang bekannt wurde. Daraufhin wurde ihr die Fahrerlaubnis entzogen, wogegen sie Beschwerde einlegte. Sie war der Ansicht, dass sie inzwischen durch die jahrelange Fahrpraxis nachgewiesen habe, dass sie ausreichende Kenntnis im Bereich des Straßenverkehrs besitze.
Das sah das OVG anders und wies die Beschwerde zurück. Für eine Fahrerlaubnis reiche es gerade nicht, nachzuweisen, dass "man fahren kann". Vielmehr sei zwingend geregelt, dass einmal ein selbst erbrachter, ordnungsgemäßer Prüfungsnachweis in Theorie und Praxis vorgelegt werden müsse. Hier aber gab es diesen ersten Nachweis nie. Wegen der Identitätstäuschung gelte die Theorieprüfung als nicht bestanden. Auch eine noch so lange unauffällige Fahrpraxis könne diesen qualifizierten Nachweis nicht ersetzen. Zudem sei zu beachten, dass die Betroffene dreimal in der Theorie durchgefallen war. Wenn dann eine andere Person die Prüfung ablegen "müsse", spreche allein dieser Vorgang schon für die Nichteignung.
Hinweis: Eine Fahrerlaubnis, die aufgrund einer Täuschung erteilt wurde, obwohl ihr Inhaber die theoretische Prüfung nicht selbst erfolgreich abgelegt hat, darf in der Regel aufgehoben werden, und zwar ohne dass dem Inhaber zuvor Gelegenheit gegeben werden muss, seine Befähigung zum Führen von Kraftfahrzeugen im Rahmen einer behördlich angeordneten Begutachtung nachzuweisen.
Quelle: OVG Lüneburg, Beschl. v. 19.11.2025 - 12 ME 92/25
| zum Thema: | Verkehrsrecht |
(aus: Ausgabe 02/2026)
Bei der Bewertung von Straßen gibt es in der Tat die Kategorie der nur "geringen Verkehrswichtigkeit", so auch für die ihr angegliederten Radwege. Was dies bedeutet, musste das Landgericht Magdeburg (LG) darlegen. Grund für diese thematische Auseinandersetzung war ein Radfahrer, der die mangelnde Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht für eine unerwünschte und folgenreiche Begegnung mit einem Ast verantwortlich machte und Regress forderte.
Der Kläger fuhr im Oktober 2024 innerorts auf einem Radweg, als er mit der Lenkstange seines Fahrrads gegen einen Ast stieß, der von einer Hecke in den Radweg geragt hatte. Den Ast habe er aus seinem Blickwinkel nicht erkennen können. Da sich die Lenkstange seines Fahrrads in dem Ast verfing, stürzte er kopfüber vom Rad auf den geteerten Radweg. Nach Ansicht des Kläger habe die Stadt damit ihre Verkehrssicherungspflicht verletzt. Sie habe die neben dem Radweg stehende Hecke zwar wenige Wochen vor dem Unfall schneiden lassen, aber nicht kontrolliert, ob ein Ast stehen geblieben ist und in den Radweg hineinragte. Der Kläger forderte Schmerzensgeld und Schadensersatz.
Das LG wies die Klage jedoch ab. Denn seiner Ansicht nach war die beklagte Stadt aufgrund der nur geringen Verkehrswichtigkeit der betreffenden Straße nicht verpflichtet, die ordnungsgemäße Ausführung der Arbeiten an der Hecke zu kontrollieren. Vielmehr konnte sich die Stadt darauf verlassen, dass das spezialisierte Unternehmen die ihm übertragenen Arbeiten fachgerecht ausführt. Der Kläger seinerseits war zudem verpflichtet, seine Fahrweise so einzurichten, dass es ihm stets möglich sei, sein Fahrrad im Fall des Auftretens unerwarteter Hindernisse abzubremsen. Wenn der Ast in Höhe des Lenkers in den Radweg ragte, sei nicht ersichtlich, warum es dem Kläger nicht möglich war, sein Fahrrad mit angemessener Geschwindigkeit noch vor einem Zusammenstoß mit dem Hindernis zum Stehen zu bringen. Sollte der Ast aus der Hecke heraus-, jedoch nicht in die Fahrbahn hineingeragt haben, hätte der Kläger die Kollision mit dem Ast und den Sturz vermeiden können, indem er mit seinem Fahrrad einen größeren Abstand zur in der Nähe des Radwegs befindlichen Hecke eingehalten hätte.
Hinweis: Auf die Berufung des Klägers hin hat das Oberlandesgericht Naumburg darauf hingewiesen, dass die Berufung offensichtlich keinen Erfolg haben wird. Das LG habe zu Recht und mit zutreffender Begründung die Klage abgewiesen. Der Kläger nahm seine Berufung daraufhin zurück.
Quelle: LG Magdeburg, Urt. v. 30.07.2025 - 10 O 240/25
| zum Thema: | Verkehrsrecht |
(aus: Ausgabe 02/2026)
Zum Thema Sonstiges
- Alles Zumutbare getan? Nicht jede Verspätung durch Blitzeinschlag zieht Anspruch auf Ausgleichszahlung nach sich
- Hündin entkommt Flugfracht: Haustiere sind bei Verlust als Reisegepäck zu werten und auf Höchstbetrag begrenzt
- Pauschalhinweis zu Corona: Ohne konkrete vertragliche Nennung der Krankheit greift Betriebsschließungsversicherung nicht
- Trotz Haftungsausschluss: Hauskauf nach arglistiger Täuschung anfechtbar
- Trotz fehlender Zulassung: Kein Rückerstattungsanspruch nach bereits in Anspruch genommenem Coaching
Das Leben ist oft unberechenbar - selbst, wenn wir alles daransetzen, es absehbarer zu gestalten. Auch Fluggesellschaften sind angehalten, alles ihnen Mögliche zu tun, um ihren Flugverkehr so zuverlässig wie möglich durchzuführen. Sonst kann es teuer werden. Was aber ihre Pflicht zur Zahlung einer Entschädigung nach einem Blitzeinschlag und den daraufhin notwendigen Maßnahmen angeht, musste kürzlich der Europäische Gerichtshof (EuGH) entscheiden.
Bei dem Vorfall wurde ein Flugzeug der Austrian Airlines kurz vor der Landung in Rumänien von einem Blitz getroffen. Dadurch mussten obligatorische Sicherheitskontrollen durchgeführt werden, die den nachfolgenden Flug nach Wien verspätet starten ließen. Ein Passagier kam mit einem Ersatzflug mehr als sieben Stunden später in Wien an und forderte deshalb eine Ausgleichszahlung von 400 EUR von der Fluggesellschaft. Die Airline argumentierte, dass der Blitzeinschlag und die erforderlichen Sicherheitsprüfungen einen außergewöhnlichen Umstand darstellten und sie selbst alle zumutbaren Maßnahmen ergriffen hatte, um die Verspätung zu begrenzen. Das zuständige österreichische Gericht legte den Fall dem EuGH zur Vorabentscheidung vor.
Der EuGH stellte klar, dass ein Blitzeinschlag, der zwingende Sicherheitskontrollen nach sich zieht, einen außergewöhnlichen Umstand darstellt, die das Flugzeug am planmäßigen Einsatz hindern. Derartige Ereignisse gehören nicht zum normalen Betrieb einer Fluggesellschaft und sind deshalb von ihr auch nicht beherrschbar. Durch die darauffolgenden Maßnahmen soll garantiert werden, dass die Sicherheit der Fluggäste immer Vorrang vor Pünktlichkeit hat. Die Fluggesellschaft kann sich genau dann von der Zahlung einer Entschädigung befreien, wenn sie nachweisen kann, dass sie alles Zumutbare unternommen hat, um die Verspätung oder deren Folgen zu vermeiden. Ob dies im konkreten Fall geschehen ist, muss nun das österreichische Gericht prüfen.
Hinweis: Ein Blitzeinschlag kann eine Fluggesellschaft von der Entschädigungspflicht befreien. Entscheidend ist, dass das Unternehmen alle möglichen Maßnahmen ergriffen hat, um Verspätungen zu verhindern. Letztlich entscheidet das zuständige nationale Gericht über die Anwendung dieser Grundsätze.
Quelle: EuGH, Urt. v. 16.10.2025 - C-399/24
| zum Thema: | Sonstiges |
(aus: Ausgabe 02/2026)
Zuerst einmal klingt es logisch: Wird etwas im Gepäck- bzw. Frachtraum eines Flugzeugs transportiert, muss es sich folglich auch um Gepäck handeln. Der hier behandelte Verlust war dann doch etwas tragischer als ein verlorener Koffer: Hier war der Verlust eines Hunds zu beklagen. Was daraus folgt, musste - wie oft bei Rechtsfragen im Flugverkehr - der Europäische Gerichtshof (EuGH) entscheiden.
Eine Frau flog im Oktober 2019 mit ihrer Mutter und ihrer Hündin von Buenos Aires nach Barcelona. Die Hündin musste wegen ihrer Größe jedoch in einer Transportbox im Frachtraum befördert werden. Die Vierbeinerin war mit dieser Entscheidung offenbar nicht einverstanden, denn dem Tier gelang es, während der Beförderung der Box zu entkommen. Sie wieder einzufangen, gelang hingegen leider nicht. Das Frauchen forderte daraufhin eine Entschädigung von 5.000 EUR, da sie den Verlust ihrer Hündin als immateriellen Schaden ansah. Die Fluggesellschaft Iberia erkannte zwar ihre Verantwortung durchaus an, zahlte aber nur den im Übereinkommen von Montreal für aufgegebenes Gepäck vorgesehenen Höchstbetrag. Die spanischen Gerichte legten den Fall dem EuGH vor, um klären zu lassen, ob Haustiere als Reisegepäck gelten.
Der EuGH stellte schließlich klar, dass Haustiere durchaus unter den Begriff "Reisegepäck" fallen. Zwar versteht man üblicherweise unter Gepäck Gegenstände, doch das Übereinkommen von Montreal schließt Tiere hierbei nicht aus. Für den Ersatz gilt daher der festgelegte Höchstbetrag von derzeit knapp unter 2.000 EUR, sofern beim Check-in kein höherer Wert angegeben wurde. Wer diesen Betrag für zu niedrig hält, kann bei Zustimmung der Fluggesellschaft einen höheren Wert festlegen und den entsprechenden Aufpreis zahlen. Dass der Tierschutz ein wichtiges Ziel der Union ist, schließt nicht aus, dass Tiere bei der Beförderung rechtlich als Gepäck behandelt werden, solange während des Transports auf ihr Wohlergehen geachtet wird.
Hinweis: Haustiere werden bei Flugreisen wie aufgegebenes Gepäck behandelt. Wer den maximalen Haftungsbetrag erhöhen möchte, muss diesen vor Abflug angeben und den Zuschlag zahlen. Die Fluggesellschaft haftet für einen Verlust nur bis zur Höhe des angegebenen oder des gesetzlich festgelegten Betrags. Doch den finanziellen Aspekt mal völlig außen vor gelassen: Da Geld den vierbeinigen Begleiter in den meisten Fällen nicht zu ersetzen vermag, versuchen Sie möglichst, Ihrem Tier diese Tortur im Frachtraum zu ersparen.
Quelle: EuGH, Urt. v. 16.10.2025 - C-218/24
| zum Thema: | Sonstiges |
(aus: Ausgabe 02/2026)
Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main (OLG) musste bewerten, ob eine abgeschlossene Betriebsschließungsversicherung Schutz für coronabedingte Schließungen bietet, obwohl COVID-19 nicht ausdrücklich im Versicherungsvertrag genannt wurde. Ob pauschale Hinweise des Versicherers auf der Website, dass das Corona-Virus "im Rahmen der Bedingungen" versichert sei, auf diese Bewertung Einfluss nahmen, lesen Sie hier.
Ein Freizeitstättenbetrieb hatte seit 2005 eine Betriebsschließungsversicherung abgeschlossen. Anfang März 2020 wurde der Vertrag durch einen Nachtrag angepasst, die Tagesentschädigung erhöht und ein Katalog meldepflichtiger Krankheiten tabellarisch aufgelistet - COVID-19 war dort noch nicht enthalten. Mitte März 2020 veröffentlichte der Versicherer auf seiner Website, dass Schäden durch das Corona-Virus "im Rahmen der Bedingungen" mitversichert seien. Ab dem 18.03.2020 musste der Betrieb aufgrund einer behördlichen Anordnung schließen. Ein Schaden von 120.000 EUR wurde gemeldet, der Versicherer lehnte die Zahlung ab.
Sowohl das zuvor mit der Sache betraute Landgericht als auch das OLG bestätigten die Ablehnung. Das OLG begründete die Entscheidung damit, dass der Vertrag nur für die ausdrücklich aufgeführten Krankheiten Versicherungsschutz bot. Die Formulierung auf der Website "im Rahmen unserer Bedingungen" machte deutlich, dass nur Leistungen nach den vertraglich vereinbarten Bedingungen erbracht werden sollten. COVID-19 war in diesen Bedingungen nicht enthalten, so dass weder eine Pflichtverletzung noch ein treuwidriges Verhalten des Versicherers vorlag. Frühere Urteile des Bundesgerichtshofs bestätigten, dass ein pauschaler Hinweis auf Versicherungsdeckung ohne konkrete Nennung der Krankheit den Vertrag nicht erweitert. Auch für den zweiten Lockdown ergaben sich keine anderen Regelungen, da die Bedingungen des Vertrags vergleichbar waren.
Hinweis: Betriebsschließungsversicherungen decken nur die im Vertrag namentlich genannten Krankheiten ab. Hinweise auf Internetseiten ändern den Umfang des Versicherungsschutzes nicht. Wer Schutz für neue Krankheiten will, muss dies ausdrücklich im Vertrag vereinbaren.
Quelle: OLG Frankfurt am Main, Urt. v. 16.06.2025 - 12 U 145/24
| zum Thema: | Sonstiges |
(aus: Ausgabe 02/2026)
Ob ein Hauskauf auch dann rückgängig gemacht werden kann, wenn zwar ein Gewährleistungsausschluss vereinbart wurde, der Verkäufer den tatsächlichen Zustand des Hauses aber verschwiegen hat, musste das Landgericht Frankenthal (LG) kürzlich beantworten. Ob der alte Spruch "Wer schreibt, der bleibt" beim vertraglichen Haftungsausschluss Verkäufer also schützt, obwohl diese ihre Kunden absichtlich getäuscht haben, lesen Sie hier.
Eine Käuferin erwarb ein Haus in Neustadt an der Weinstraße für über 600.000 EUR unter Ausschluss der Gewährleistung. Im Expose des Maklers wurde das Haus als "liebevoll kernsaniert" angepriesen. Die Verkäuferin verschwieg jedoch ein wichtiges Detail: Einige Monate zuvor hatte sie erfahren, dass für die Außentreppe und die Terrasse keine Baugenehmigungen bestanden. Nach dem Kauf forderte die Stadtverwaltung die Käuferin daher auch auf, die baulichen Anlagen zu entfernen. Zusätzlich stellte ein von der Käuferin beauftragter Elektriker fest, dass die Elektroinstallation nicht neuwertig war, sondern noch aus den 1990er Jahren stammte. Die Käuferin erklärte daraufhin die Anfechtung wegen arglistiger Täuschung und trat hilfsweise vom Vertrag zurück. Die Verkäuferin berief sich jedoch auf den vereinbarten Gewährleistungsausschluss.
Das LG gab der Käuferin dennoch Recht. Der Kaufvertrag konnte wegen arglistiger Täuschung aufgehoben werden, da die Verkäuferin den Konflikt mit der Stadt und den tatsächlichen Zustand des Hauses verschwiegen hatte. Das Expose vermittelte den Eindruck einer nahezu neuwertigen Kernsanierung, was nicht der Realität entsprach. Die Elektroinstallation erfüllte nicht den versprochenen Standard, und die Verkäuferin konnte sich nicht auf den Gewährleistungsausschluss berufen, weil sie die Renovierungen selbst durchgeführt und den wahren Zustand des Hauses gekannt hatte.
Hinweis: Ein Gewährleistungsausschluss schützt Verkäufer nicht vor den Folgen der arglistigen Täuschung. Käufer können den Kaufvertrag anfechten und ihr Geld zurückverlangen, wenn der Verkäufer wesentliche Mängel verschwiegen hat. Auch unzulässige bauliche Veränderungen können eine Rückabwicklung rechtfertigen.
Quelle: LG Frankenthal, Urt. v. 01.10.2025 - 6 O 259/24
| zum Thema: | Sonstiges |
(aus: Ausgabe 02/2026)
Erworbene Produkte kann man umtauschen, wenn man merkt, dass damit irgendetwas nicht stimmt. Doch wie sieht es mit bereits vermitteltem Wissen aus, wenn dem Anbieter selbst die Zulassung zur Wissensvermittlung gefehlt hat? Kann ein Coachingteilnehmer sein Geld zurückfordern, wenn der Anbieter keine Zulassung nach dem Fernunterrichtsschutzgesetz (FernUSG) besitzt, das Coaching hingegen bereits in Anspruch genommen hat? Das Amtsgericht Paderborn (AG) hat dazu eine klare Meinung.
Die Teilnehmerin hatte im März 2023 online einen Vertrag über ein achtwöchiges Coachingprogramm abgeschlossen und insgesamt 3.570 EUR in vier Raten bezahlt. Das Programm beinhaltete etwa 100 Stunden Videomaterial, von denen sie über 70 Stunden nutzte, sowie eine Gruppe mit Coaches und anderen Teilnehmern zum Austausch und für Fragen. Die Anbieterin verfügte jedoch nicht über die nach § 12 FernUSG erforderliche Zulassung von Fernlehrgängen. Die Teilnehmerin forderte im September 2023 schließlich die Rückzahlung des vollen Betrags, da der Vertrag wegen fehlender Zulassung nichtig sei, und führte an, dass nur ein Teil des Programms synchron stattgefunden habe und ein Missverhältnis zwischen Leistung und Preis bestanden habe. Die Anbieterin widersprach und argumentierte, das FernUSG gelte nicht, da die Teilnehmerin selbständig tätig sei und der Vertrag keine reine Verbraucherdienstleistung darstelle.
Das AG wies die Klage ab. Das Gericht stellte fest, dass der Vertrag zwar wegen fehlender Zulassung nach § 7 Abs. 1 FernUSG nichtig war, die Anbieterin jedoch Anspruch auf Wertersatz für die bereits erbrachten Leistungen hatte. Die Videos, Livecalls und sonstigen Angebote hatten einen Wert von 3.570 EUR, der den Rückzahlungsanspruch vollständig ausglich. Eine Rückzahlung wurde daher auf null reduziert. Entscheidend war, dass die Teilnehmerin die Inhalte genutzt und davon profitiert hatte.
Hinweis: Ein Vertrag ohne erforderliche FernUSG-Zulassung kann zwar nichtig sein, der Anbieter darf jedoch bereits erbrachte Leistungen in Rechnung stellen. Bereits genutzte Inhalte führen dazu, dass der Rückzahlungsanspruch entfällt. Rückforderungen scheitern regelmäßig an der Saldierung von Leistung und Gegenleistung.
Quelle: AG Paderborn, Urt. v. 05.09.2025 - 57a C 183/24
| zum Thema: | Sonstiges |
(aus: Ausgabe 02/2026)
Bürozeiten
- Montag - Freitag
- Termine nach Vereinbarung
Anfahrt
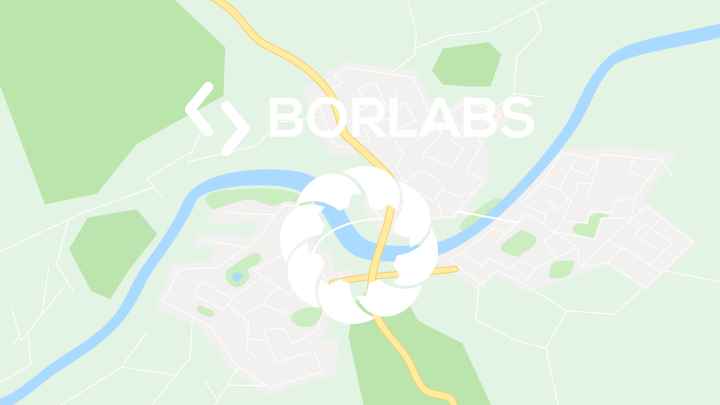
Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren